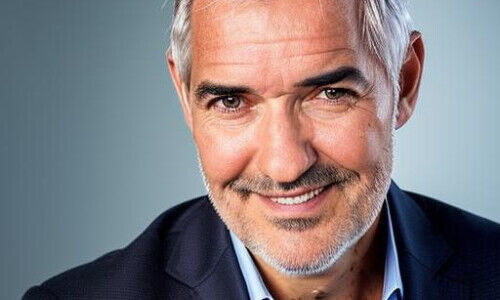UBS-Schweiz-Chef Lukas Gähwiler über die Komplexität in seinem Geschäftsbereich, drohende Kosten für die Kunden, die Folgen der Zuwanderungs-Initiative und besorgte Investoren aus dem Ausland.
Die UBS arbeitet daran, sich eine Holdingstruktur mit eigenständigen Tochtergesellschaften zu geben, darunter auch eine Schweiz AG. Ein anspruchsvolles Unterfangen, wie UBS-Schweiz-Chef Lukas Gähwiler feststellt.
Die neue Struktur sei eine Folge aus der Debatte um «Too big to fail», sagte UBS-Schweiz-Chef Lukas Gähwiler (Bild) am Wochenende in einem Interview mit dem «St. Galler Tagblatt» (Artikel kostenpflichtig). Die Schaffung einer eigenen UBS Switzerland AG sei ohne Zweifel ein Riesenprojekt.
Veränderungen für ganz grosse Kunden
«Es ist von der technischen Komplexität her sogar anspruchsvoller als die Fusion von Bankgesellschaft und Bankverein zur UBS im Jahr 1998. Das liegt daran, dass es einfacher ist, Dinge zusammenzuführen, als sie wieder zu entflechten», so der 49-jährige Gähwiler weiter.
Die neue Struktur im Hintergrund werde aber so gut wie keinen Einfluss auf die Art des Geschäfts, auf Mitarbeitende oder Kunden in der Schweiz haben. Von den hiesigen 2,7 Millionen Kunden werde es für 99 Prozent gleich weitergehen wie bisher. Einzig ganz grosse Kunden würden neu eine Geschäftsbeziehung zu mehreren Rechtseinheiten innerhalb der UBS-Gruppe haben.
Kritik am Fidleg
Kritisch geht Gähwiler auf das geplante Finanzdienstleistungsgesetz (Fidleg) ein, dass derzeit in der Vernehmlassung ist. Grundsätzlich begrüsse er es, wenn ein Gesetz den Anlegerschutz regle. Aber dies müsse vernünftig und verhältnismässig geschehen.
Das Fidleg habe denn auch gute Ansätze, so unterstütze die UBS beispielsweise das Abschlussprotokoll, die Aufklärung des Kunden über allfällige Risiken sowie den Einbezug aller Vermögensverwalter. Bedenken äussert Gähwiler jedoch gegenüber der Beweislastumkehr, der Prozesskostenvorfinanzierung oder Verbandsklagen.
Nicht im Sinne der Konsumenten
«Das sind Vorschläge, die das schweizerische Rechtsverständnis auf den Kopf stellen und ein bürokratisches Monstrum schaffen. Wir haben eine funktionierende Zivilprozessordnung, die das Vertragsrecht regelt. Zudem würden solche Vorschriften im Finanzsektor den Weg bereiten, dass diese auch in anderen Branchen Einzug halten. Das würde der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz schaden», betont Gähwiler.
Klar ist auch, dass eine schärfere Regulierung, erhöhte Dokumentationspflichten und mehr Administration die Kosten erhöhen. Diese (Kosten) müsse die Bank irgendwo überwälzen können. «Ist die Dienstleistung aber schlicht zu teuer, kann sie nicht mehr angeboten werden oder nur noch in grösseren Kundensegmenten. Das kann nicht im Sinne der Konsumenten sein», sagt Gähwiler.
Privatbanken erst am Anfang
Mit Blick auf die grossen Veränderungen, die sich derzeit in der Schweizer Bankbranche abspielen, sagte Gähwiler gegenüber dem «St. Galler Tagblatt»: «Bei Banken, die vor allem mit Schweizer Kunden geschäften, haben wir schon eine relativ hohe Konzentration: Die beiden Grossbanken, Raiffeisen, die Kantonalbanken, Migros Bank und Bank Coop zusammen haben einen Marktanteil von über 90 Prozent. Unter den kleineren Regionalbanken kommt es sicher zu weiteren Zusammenschlüssen oder Übernahmen durch eine grössere Bank.»
Aber dies seien Arrondierungen, die es früher schon gegeben habe. Dagegen stehe man bei den Privatbanken erst am Anfang einer grossen Konsolidierungswelle, vor allem bei jenen, welche die grenzüberschreitende Vermögensverwaltung als Geschäftsmodell hätten, sagt Gähwiler, denn «die Verwaltung unversteuerter Gelder ist kein Geschäftsmodell mehr.»
Lehrlinge gesucht
Der UBS-Schweiz-Chef räumt auch ein, dass selbst die grösste Bank der Schweiz in gewissen Regionen und Bereichen Mühe habe, geeignete Lehrlinge und Nachwuchskräfte zu finden. «Die ganze Schweiz läuft in einen akuten Mangel an Arbeitskräften hinein», warnt Gähwiler und spielt dabei auf diverse politische Vorstösse der letzten Zeit an, wie die Minder-Initiative oder die Masseneinwanderungsinitiative.
Und der UBS-Manager sagt klar: «Wir erhalten hierzu vermehrt besorgte Fragen von ausländischen Investoren, vielleicht auch, weil sie mit der direkten Demokratie der Schweiz weniger vertraut sind.»
Potenzial im Inland besser nutzen
Gähwiler betont aber auch, was die UBS im Nachwuchssektor tut: «Wir investieren sehr viel in die Aus- und Weiterbildung. Die UBS hat 1'800 Ausbildungsplätze, und wir versuchen, die jungen Berufsleute dann wenn immer möglich zu übernehmen. Generell müssen wir das Potenzial inländischer Arbeitskräfte besser nutzen», unterstreicht Gähwiler.
-
Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.4%
-
Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.19.2%
-
Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.27.95%
-
Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.24%
-
Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.21%