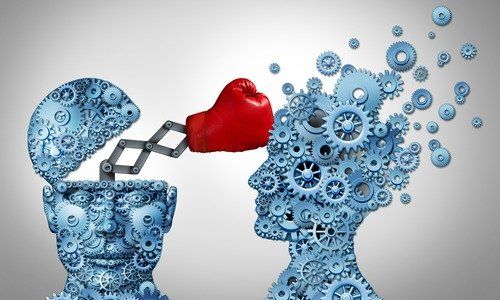Staatsinstitute gelten als träge und dem Private Banking gegenüber wenig affin. Hiere sind acht Gründe, warum das ein folgenschwerer Trugschluss sein könnte.
Die Konsolidierung im Swiss Banking rollt – seit dem Frankenschock erst recht. Je nach Prognose wird damit gerechnet, dass hierzulande in den nächsten Jahren 30 bis 80 Institute verschwinden werden. Als besonders gefährdet gelten dabei kleine und mittelgrosse Privatbanken: Dort stagnierten zuletzt oftmals die Kundengelder, während die Kosten rapide anstiegen.
Wie wenn jene feinen Häuser nicht schon genug Probleme hätten, erwächst ihnen jetzt noch verschäfte Konkurrenz aus einer unerwarteten Ecke. Ausgerechnet die als behäbig geltenden Schweizer Kantonalbanken haben nämlich das Zeug dazu, den Banquiers privés gefährlich zu werden. Denn die Staatsbanken verfügen über beste Voraussetzungen, um bei einer vermögenden Schweizer Klientel zu punkten. Das sind acht Gründe dafür:
1. Kantonalbanken verfügen über die schiere Masse
Zugegeben, die begehrten schwerreichen Private-Banking-Kunden dürften nur in kleiner Zahl den Weg zur Kantonalbank finden. Doch was die Staatsbanken an Klasse abgeht, machen sie durch Masse wett. So verwalteten die 24 Kantonalbanken im Jahr 2014 hierzulande Kundengelder von mehr als 340 Milliarden Franken – immerhin 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Und während das Zinsengeschäft immer noch zwei Drittel der Ertrags der Staatsinstitute ausmacht, erwirtschafteten sie immerhin 2 Milliarden Franken im Kommissionsgeschäft.
Über alle Sparten besehen hält die Kantonalbanken-Gruppe gar einen Drittel des gesamten Schweizer Bankgeschäfts in ihrer Hand. Genug, um die Private-Banking-Landschaft in der Schweiz massiv zu beeinflussen.
2. Kantonalbanken sind breiter aufgestellt
Die Vermögensverwaltung ist dabei nur eine Disziplin, welche die Kantonalbanken praktizieren. Alle Institute pflegen auch das Kredit- und Hypothekargeschäft, manche Bank auch das Firmenkundengeschäft. Sie verfügen damit nicht nur über ein breiteres Banking-Know-how, sondern auch über einen bestehenden Pool potenzieller Private-Banking-Kunden.
Für Kantonalbanken ist es auf Grund der wohl noch längere Zeit tieferen Zinsmargen eine Notwendigkeit, bestehende Kundenbeziehungen zu vertiefen – den so genannten «Share of wallet» pro Kunde zu erhöhen. Die Institute werden also versuchen, aus einem KMU-Kunden oder Hypothekarkredit-Nehmer auch einen Vermögensverwaltungskunden zu machen.
3. Kantonalbanken sind näher beim Kunden
Seit vor gut fünf Jahren die Weissgeld-Ära eingeläutet wurde, hat bei den Privatbanken eine Besinnung auf dem Heimmarkt eingesetzt. Beim Buhlen um diese allseits begehrte Klientel haben die Kantonalbanken gegenüber den Privatbanken einen entscheidenden Vorteil: Sie sind bereits beim Kunden angekommen, und zwar mit einem zumeist weitgespannten Filialnetz.
Die Visibilität hilft, Gelder anzuziehen, derweil die Privatbanken auch als Marke meist kaum bekannt sind. Auch das ist der Vergangenheit geschuldet: Früher war die Anonymität ein wichtiger Teil des Businessmodells der Banquiers privés. Heute hingegen ist Publizität und Transparenz gefragt.
4. Kantonalbanken sind Digitalisierer der ersten Stunde
Aus der Nähe und der schieren Masse der Kundschaft ergibt sich eine noch grössere Fülle an Kundendaten. Und die sind künftig im Private Banking Trumpf. So kommt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Beratungsunternehmens KPMG Schweiz zum Schluss, dass «Big Data» unabdingbar sein werde, um Private-Banking-Kunden effizient anzusprechen und zu bedienen. Aus den Daten kann jedoch nur lesen, wer die digitalen Werkzeuge dazu besitzt.
Diesbezüglich kommt die KPMG-Studie zu einem überraschenden Befund: Zahlreiche Privatbanken verschlafen den Trend der Digitalisierung, während die Staatsinstitute dort ganz vorne mittun. Während nämlich sämtliche befragten Kantonalbanken auf neue Technologien und Absatzkanäle setzen, gab die Hälfte der auf die Schweiz fokussierten Privatbanken an, sich nur auf die Kunden zu konzentrieren.
Das dürfte sich rächen. Die Umstellung auf die neuen Technologien dauert drei bis vier Jahre – Zeit, die jene gewinnen, die den Wandel heute schon anpacken. Bezeichnenderweise sind es Staatsbanken wie die Glarner oder die Basler Kantonalbank, die in jüngster Zeit mit Digitalisierungs-Offensiven in der Vermögensberatung von sich reden gemacht haben.
5. Kantonalbanken sind effizienter
Der digitale Wandel bedingt zwar erhebliche Investitionen. Doch die können sich die Kantonalbanken eher leisten als alteingesessene Privatbanken. So ist es inzwischen eine Binsenwahrheit, dass im Swiss Private Banking die Salärstrukturen aufgeblasen sind. Vor schmerzhaften Schnitten scheuen die Privatbanken aber zurück – aus Furcht, Kundenberater zu verlieren. Die Folge ist eine zu hohe Kostenbasis, welche für die Zukunft wichtige Investitionen einschränkt.
Kantonalbanken sind dagegen deutlich effizienter, wie eine Analyse von finews.ch kürzlich zeigte. Die Saläre ihrer Kundenberater sind tiefer als in den Private-Banking-Metropolen Zürich und Genf. Mit ihrer Lohnpolitik bleiben sie im «War for Talents» zwar mehrheitlich aussen vor und können so auch keine UHNWI-Teams von Konkurrenten abspenstig machen. Doch die Kantonalbanken sind dadurch flexibler und weniger abhängig von so genannten Starbankern.
6. Kantonalbanken sind stabiler und besser kapitalisiert
In Zeiten der Verunsicherung auf dem Schweizer Finanzplatz ist die Stabilität der Kantonalbanken Trumpf. Dies zeigte sich letztmals in der Finanzkrise, als Private-Banking-Kunden zuhauf ihr Vermögen bei den Kantonalbanken in Sicherheit brachten. Einen grossen Anteil daran hat die Staatsgarantie, welche 21 der insgesamt 24 Institute geniessen.
Hinzu kommt: Mit dem Staat im Rücken, der in der Regel sehr guten Kapitalisierung und der deswegen günstigeren Refinanzierung sind die Kantonalbanken gerüstet, die immensen Kosten der Regulierung zu tragen. Weiter haben sie den finanziellen Spielraum, gezielt in bestimmte Marktsegmente zu investieren oder gar Übernahmen zu tätigen.
7. Kantonalbanken reden ganz oben mit
Politik und Kantonalbanken sind untrennbar miteinander verbunden – im Guten wie im Schlechten. Zuletzt vermochten die Kantonalbanken diese Bindung jedoch zu ihren Gunsten zu nutzen.
Im Jahr 2012 schlossen sie sich der Interessensgruppe Inlandbanken an und lobbyieren seither mit einigem Erfolg gegen neue Bankgesetze – oftmals in direktem Widerspruch zur Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg), wo die Privatbankiers traditionell das Zünglein an der Waage spielten. Wenn es darum geht, beim Bund optimale Bedingungen fürs eigene Geschäft herauszuschlagen, haben die Kantonalbanken die Nase vorn.
8. Kantonalbanken kommen einfach besser an
Privatbankiers vergleichen sich gerne mit Vertrauensärzten oder mit Rechtsanwälten, zu denen die Klientel ebenfalls ein sehr enges Verhältnis hat. Mit anderen Worten, es ist auch ein Bauchgefühl, dass mitspielt, wenn man sich für eine Bank entscheidet. Und da haben sich die Zeiten tatsächlich geändert. Denn das Bauchgefühl vieler Kunden sagt heute in bezug auf Privatbanken eher Nein.
Zu sehr haftet den Privatbanken inzwischen das Image an, allzu lange dubiosen Praktiken nachgegangenen zu sein und Schwarzgeld von ausländischen Kunden gehortet zu haben. Ausserdem mutet die zum Teil bis zum Exzess praktizierte Zurückhaltung und Noblesse heute eher wie Arroganz an.
Anders die Kantonalbanken. Mit ihrer Bodenständigkeit, ihrem unkomplizierten Umgang und einer durch und durch sympathischen Ausstrahlung sprechen sie mittlerweile auch sehr vermögende Kunden positiv an – Reiche, die genug haben vom ganzen Private-Banking-Theater, das am Ende des Tages häufig auch nicht viel gebracht hat – ausser Spesen.
-
Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.61%
-
Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.19.2%
-
Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.27.53%
-
Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.42%
-
Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.24%