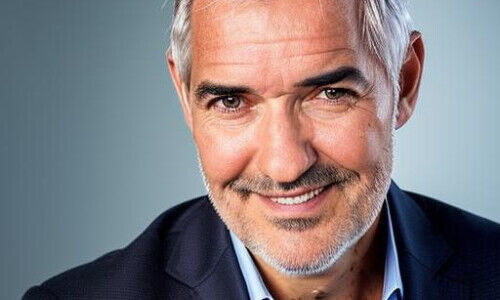Seit Anfang Jahr rollt in Deutschland die Bussenlawine gegen Schweizer Banken. Medien wollen jetzt aber von geheimen Verhandlungen wissen, welche das brachiale Vorgehen wohl verhindert hätten. Dabei spielte offenbar die Schweizerische Bankiervereinigung eine entscheidende Rolle.
Letzten Januar bliesen die Steuerfahnder im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen zum Generalangriff. Gestützt auf Tausende von Daten über deutsche Steuerflüchtlinge mit Schwarzgeld in der Schweiz knöpfen sie sich seither die hiesigen Banken einzeln vor – und setzen dabei brachialen Druck auf.
Das Vorgehen ist im Kern stets dasselbe. Die deutschen Beamten fordern eine Busse. Ansonsten drohen sie der jeweiligen Bank, einzelne Mitarbeiter wegen des Verdachts auf Beihilfe zur Steuerhinterziehung einzuklagen, berichten Kenner der Verhandlungen. Hierzulande sprechen denn nicht wenige hinter vorgehaltener Hand von «Erpressung».
Druck zeigt Wirkung
Doch die Technik erweist sich als überaus wirkungsvoll. Wie auch finews.ch berichtete, zahlte die Basler Kantonalbank (BKB) letzten Mai eine Busse von knapp 39 Millionen Euro, um mit den deutschen Behörden eine Einigung zu erzielen. Wie damals spekuliert wurde, droht unter anderem der Bank Vontobel sowie den Zürcher, Thurgauer und Graubündner Kantonalbanken dasselbe Schicksal.
Auch die Deutsche Bank (Schweiz), J. Safra Sarasin sowie die Basler La Roche 1787, die inzwischen von der Notenstein Privatbank übernommen worden ist, stünden im Fokus der Fahnder aus Nordrhein-Westfalen, hiess es damals.
Das deutsche «Handelsblatt» (Artikel bezahlpflichtig) schreibt nun, dass die «Liste» der Fahnder noch wesentlich länger sei. «Es sind viele», zitiert die Wirtschaftszeitung den Kölner Oberstaatsanwalt Norbert Reifferscheidt. Die Schweizer «NZZ» hatte letzten Juli bereits «von weit über 30 Instituten» auf der fraglichen Liste gesprochen.
Unblutige Lösung?
Brisant: Laut dem «Handelsblatt» hätte der Sturmangriff aus dem Nachbarland wohl vermieden werden können. So hätten die Steuerfahnder dem Swiss Banking vor zwei Jahren aus eigenem Antrieb eine weit weniger blutige Lösung vorgeschlagen.
Dazu zitiert das Blatt den deutschen Steueranwalt Dieter Bohnert von der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek, die auch an der Zürcher Bahnhofstrasse ein Büro unterhält. Der Anwalt berichtet, die Fahnder selbst hätten ihn Ende 2013 gebeten, mit der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) informell die Möglichkeit einer umfassenden Lösung deren Mitglieder im Steuerstreit auszuloten.
Im Kern sei es darum gegangen, dass eine Bank Kunden und Mitarbeiter zu einer Selbstanzeige bewegt, sagte Bohnert gegenüber dem «Handelsblatt». Das hätte den Vorteil gehabt, dass beide straffrei ausgegangen wären und auch für die Banken keine Verbandsbusse festgesetzt hätte werden können. Und nicht zuletzt hätten sich die Steuerbehörden selber viel Arbeit erspart.
SBVg reagierte nicht
Möglicherweise wäre das der Weg des geringsten Übels gewesen. Doch die SBVg, sagt Bohnert, habe nicht auf diesen Vorstoss reagiert. «Hätte die Bankiervereinigung das Gesprächsangebot aufgegriffen, hätte sie ihren Mitgliedern die Kosten für die Bussen womöglich ersparen können», gab der Anwalt zu bedenken. «Dass die Strafverfolgungsbehörden selbst diesen Vorschlag gemacht haben, hat die Aussichten für solch ein Vorgehen ungemein verbessert.»
Laut dem «Handelsblatt» sehen das auch einige Schweizer Banker so. «Das ist eine verpasste Chance», wird ein unerkannt bleiben wollender Chef einer Privatbank zitiert.
Rechtliche Hindernisse
Ein SBVg-Sprecher bestätigte gegenüber dem deutschen Blatt Bohnerts Vorschlag – verwies aber darauf, dass der Verband nie offiziell eine Offerte erhalten habe. «Eine Zusammenarbeit wäre für uns rechtlich unmöglich gewesen», wird der Sprecher zitiert.
Damit war der Vorschlag im Keim erstickt. Und laut dem Bericht würde ein ähnliches Abkommen heute nicht mehr funktionieren. Den Schweizer Banken bleibt damit nur, der Bussenlawine aus Deutschland entgegenzutreten.
-
Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.68%
-
Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.19.15%
-
Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.27.75%
-
Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.22%
-
Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.21%