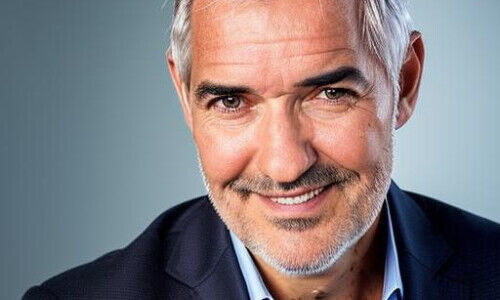Weder Manager noch Verwaltungsräte der Credit Suisse und UBS müssen sich Sorgen machen, dass die Aktionäre die Vergütungsberichte ablehnen. Die Löhne auf den Top-Etagen der Banken steigen wieder.
1. Selbstsicherheit statt Panik
Vor drei Jahren geriet die mit Teppichen gepolsterte Welt des Schweizer Wirtschafts-Establishment aus den Fugen. Die Abstimmung über die Volksinitiative gegen die Abzockerei («Minder-Initiative») liess sich nicht weiter hinauszögern. Die Lobby-Abwehr erwies sich als wirkungslos. Wie bös überrumpelt die Firmenlenker wurden, zeigte der Fall des abtretenden Novartis-Präsident Daniel Vasella, der sich sein Konkurrenz-Verbot vom Pharma-Riesen noch mit 72 Millionen Franken vergolden lassen wollte. Und damit den Weg zum Sieg der Initianten ebnete.
Seit der Annahme des Begehrens im März 2013 haben Aktionäre nun die Pflicht, jährlich über die Vergütungen abzustimmen und Verwaltungsräte im Amt zu bestätigen. Lang gehegte Pfründen schienen somit umittelbar in Gefahr.
Seit Ende 2015 sind die «Minder»-Regeln von den Schweizer Firmen nun definitiv umgesetzt – und die Panik in der Teppichetage einer neuen Selbstsicherheit gewichen. Mit Zuversicht stellen sich umstrittene Verwaltungsräte der jährlichen Wiederwahl. Und zuversichtlich schlagen sie den Aktionären steigende Cheflöhne vor. Denn sie wissen: sie kommen damit durch.
2. Es gibt nur einen Trend – mehr und höher
UBS-CEO Sergio Ermotti ist das herausragende Beispiel, wie sich die Managerlöhne bei den Banken – aber auch in anderen Branchen – wieder stetig in die Höhe schrauben. Mit 14,3 Millionen Franken war er 2015 erstmals der bestverdienende CEO eines Schweizer Unternehmens.
Ermottis Lohn hat sich seit seinem Antritt somit mehr als verdoppelt. Nun kann man argumentieren, er habe einen guten Job gemacht, die Bank stabilisiert. Am Aktienkurs ist dies jedenfalls nicht so deutlich ersichtlich wie an Ermottis Lohn. Der wird vom Verwaltungsrat – wo Präsident Axel Weber notabene über 6 Millionen Franken verdient – mit dem Gewinnsprung von 80 Prozent begründet. Letzterer beruht aber unter anderem auf tieferen Rückstellungen für Strafzahlungen und Steuergutschriften.
Ermotti ist indes in guter Gesellschaft. Eine von der HKP Group kürzlich veröffentlichte Lohnstudie zeigt, dass die CEO der SMI-Unternehmen insgesamt 11 Prozent mehr verdienten als im Vorjahr. Insgesamt zeigt sich: Bei guten Geschäften ist das «Upside» der Manager enorm. Bei schlechtem Geschäftsgang hält sich das «Downside» in engen Grenzen.
3. Die Exzesse sind auch heute noch da
Lohnobergrenzen, Minder-Initiative und strengere Bonus-Regulierung verhindern inzwischen exzessive Salärpakete wie sie vor der Finanzkrise teilweise noch geschnürt wurden. Man erinnert sich an Marcel Ospel, der sich 2006 rund 26,6 Millionen Franken auszahlen liess. Oder Brady Dougans 90 Millionen Franken, die er 2009 aufgrund eines Bonusprogramms erhielt.
Aber Zeichen von Exzessen sind auch heute noch da. Tidjane Thiam erhielt bei der Credit Suisse für sechs Monate Arbeit 4,6 Millionen Franken – obwohl er auf 40 Prozent des Bonus verzichtete. Ausserdem wurden ihm 14,6 Millionen Franken in aufgeschobenen Aktien-Vergütungen zugeteilt – als Kompensation für Zahlungen, die ihm bei seinem vorherigen Arbeitgeber Prudential entgangen sind.
Das sind die Gepflogenheiten der Branche. Als Alex Friedman von der UBS zu GAM wechselte, erhielt er über 15 Millionen Franken. In anderen Branchen zeigt sich ähnliches, dafür nur zwei Beispiele: Dem Syngenta-Management war 2014 eine Lohnerhöhung von über 60 Prozent gewährt worden. Nun wird das Unternehmen verkauft. Beim Zürcher Verlagshaus Tamedia verdiente CEO Christoph Tonini mit 6 Millionen Franken doppelt so viel wie im Vorjahr – wegen des Aufwertungseffekts einer Beteiligung.
4. Das Schweigen der Aktionäre
Ausser der Stiftung Ethos und dem Vermögensverwalter zCapital legt sich in der Schweiz kein Aktionär mit dem Verwaltungsrat wegen zu hoher Vergütungen an. Zwar gelingen diesen Stimmrechtsvertretern an den Abstimmungen zu den Vergütungsberichten jeweils Achtungserfolge – im Sinne, dass eine Diskussion über die Saläre geführt wird. Mehr aber nicht.
Das Prinzip des Depotstimmrechts ist ein Garant dafür, dass sämtliche Anträge der Verwaltungsräte angenommen werden. Gewichtige Aktionäre wie der Norwegische Staatsfonds oder der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock mischen sich in die Gestaltung der Salärpakete nicht ein – wenigstens nicht öffentlich. Angelsächsische Investoren treten bezüglich Leistungsforderungen an Management und Verwaltungsrat schon mal forsch auf. Bei den Löhnen schauen sie aber bis auf wenige Ausnahmen weg.
Das hat mehrere Gründe: Sie fürchten Abgänge im Management, was Unternehmen und Rendite destabilisieren könnte. Und nicht zuletzt sind sie Teil der Branche, in der generell die höchsten Vergütungen bezahlt werden. Ins eigene Fleisch will sich niemand schneiden.
5. Der Tanz um das goldene Kalb
Hinzu kommt, dass das Argument mit dem Konkurrenzvergleich immer noch sticht. Dies insbesondere im Finanzwesen, wo der Arbeitsmarkt zuweilen jenem für Spitzenfussballer gleicht. Die Arbeitgeber versprechen sich von «Stars» hohe Zusatzeinnahmen und sind deshalb bereit, Talente in Gold aufzuwiegen. Die Verwaltungsräte orientieren sich bei der Festsetzung der Lohnhöhe an der Konkurrenz – allen voran jener aus den USA.
Wer unterdurchschnittliche Löhne bezahlt oder von Gesetzes wegen keine «branchenkonformen» Saläre vergüten darf – wie im Falle der Aargauischen Kantonalbank (AKB) – ist im Nachteil. Das Institut suchte über ein Jahr lang nach einem neuen CEO, wie auch finews.ch berichtete.
Das zeigt: Solange die Mehrheit der Banken ihre Topleute mit hohen Boni an sich binden, wird der Tanz um das Goldene Kalb anhalten.
6. Die Fundamentalopposition ist verstummt
Nichts zeigt den Sieg des Wirtschafts-Establishment schliesslich besser als die Vorgänge der letzten Tage. So stellte sich die Aktionärsrechtsvertreterin Ethos medienwirksam gegen die hohen Boni bei der CS. Wie auch finews.ch berichtete, rügte Ethos insbesondere den umstrittenen Bankpräsidenten Urs Rohner. Dennoch zeigte sich der Stimmrechtsvertreter letztlich bereit, diesen wieder zu wählen.
Offensichtlich sind die Zeiten der Fundamentalopposition gegen die Bonikultur und ihre Verfechter in den Aufsichtsgremien definitiv vorbei. Die Firmenlenker haben hierzulande einige Regeln mehr abzuhaken – und können dann schalten, wie es ihnen gefällt.
-
Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.66%
-
Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.19.13%
-
Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.27.82%
-
Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.14%
-
Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.24%