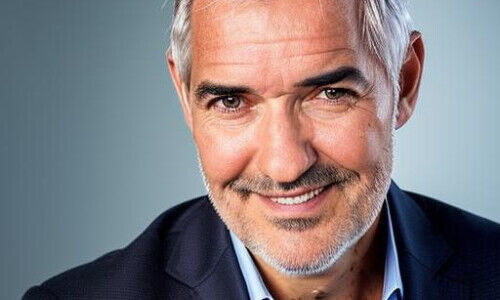Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Dieses Sprichwort bringe die Entwicklung des laufenden Jahres treffend auf den Punkt, findet Albert Steck auf finews.first.
Dieser Beitrag erscheint in der Rubrik finews.first. Darin nehmen renommierte Autorinnen und Autoren Stellung zu Wirtschafts- und Finanzthemen. Dabei äussern sie ihre eigene Meinung. Die Texte erscheinen auf Deutsch und Englisch. finews.first läuft in Zusammenarbeit mit der Genfer Bank Pictet & Cie. Die Auswahl und Verantwortung der Beiträge liegt jedoch bei finews.ch.
Mehrfach in diesem Jahr verfielen die Märkte in Panik – und stets war es ein Fehlalarm. Diese Nervosität kommt nicht von ungefähr. Das Jahr begann gleich mit einem Börsencrash: Rund um den Globus fielen die Aktienkurse und rasch war vom «miserabelsten Jahresauftakt aller Zeiten» die Rede.
Sogleich traten Analysten auf den Plan, welche die Anleger warnten, sie müssten nun besonders vorsichtig sein. Dabei ist ein solcher Rat völlig nutzlos: Eine erhöhte Vorsicht hätte es nämlich gebraucht, bevor die Kurse einbrachen – als man genau keine Warnungen zu hören bekam.
Geradeso billig und nichtssagend ist die häufig geäusserte Erklärung nach einem Kurssturz, dass die Risiken jetzt gestiegen seien. Denn effektiv bestanden diese Gefahren ja schon vorher. Nur wurden sie vom Markt eben vernachlässigt, weshalb das Risiko einer negativen Überraschung vor dem Börseneinbruch nicht kleiner, sondern im Gegenteil grösser war. Wenn aber die Kurse bereits tief sind, sinkt auch das Potenzial für weitere Verluste – die Fallhöhe für den Anleger nimmt folglich ab. Gleichzeitig führen die günstigeren Kurse dazu, dass die Aktien attraktivere Bewertungen aufweisen.
«Schon nach zwei Wochen war der Brexit-Blues bereits vergessen»
Wer sich von der Schwarzmalerei nicht aus dem Konzept bringen liess, brauchte es nicht zu bereuen: Von Mitte Februar bis Anfang Juni legte die Schweizer Börse um stolze 15 Prozent zu. Bis der 23. Juni kam. Und mit dem Brexit begann das gleiche Schauspiel von Neuem.
Die Börsen machten schon wieder auf Panik und wendige Experten rechneten aufs Komma genau vor, wie viel Wachstum uns der Entscheid kosten werde. Indes, die düsteren Prophezeiungen überdauerten auch diesmal nur kurz: Das Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) erzielte im zweiten Quartal ein erfreuliches Plus von 0,6 Prozent. Im Jahresvergleich wuchs das BIP real um 2,0 Prozent. Worauf die Auguren ihre zuvor gesenkten Prognosen reihum nach oben revidierten.
Ebenso flatterhaft verhielt sich die Börse: Nach zwei Wochen war der Brexit-Blues bereits vergessen. Zahlreiche Indizes kletterten gar auf ein neues Allzeithoch, zum Beispiel in den USA sowie bei den mittelgrossen Aktien in der Schweiz. 2016 wird uns folglich als das Jahr der abgesagten Katastrophen in Erinnerung bleiben.
«Es sind die Notenbanken selbst, die immer wieder neue Bedrohungen heraufbeschwören»
Nun könnte man dies als Kapriolen von ein paar hyperaktiven Börsianern abtun – nach dem Motto «die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter». Doch greift eine solche Interpretation zu kurz. Weshalb?
Die Entwicklung der Finanzmärkte wird je länger, desto mehr von den Notenbanken dominiert. Mit ihren weit geöffneten Geldschleusen signalisieren sie den Märkten: «Macht euch keine Sorgen, wir haben die Lage im Griff.» Nur allzu begierig vertrauen die Börsen auf diese Zusicherung und schalten in den «Risk-on-Modus» (will heissen: riskante Anlagen werden bedenkenlos gekauft).
Gleichzeitig aber sind es die Notenbanken selbst, welche immer wieder neue Bedrohungen heraufbeschwören – als Begründung dafür, dass sie die Zinsschraube (noch) nicht anziehen dürfen. Effektiv haben die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan ihre Feuerkraft in diesem Jahr weiter vergrössert. Als Sinnbild dafür dient die längste historische Zinsreihe, welche bis auf das Jahr 1517 zurückgeht: jene der niederländischen Staatsanleihen. Erstmals seit 499 Jahren ist diese jetzt unter null gefallen.
«In diesen Phasen schalten die Märkte dann plötzlich auf Risk-off»
Doch je mehr die Notenbanken aus allen Rohren feuern, desto banger stellen sich die Märkte die Frage, ob das geldpolitische Arsenal vielleicht schon bald aufgebraucht ist – was die Währungshüter jeweils mit Vehemenz verneinen. Immer wieder platzen an den Börsen daher Mutmassungen auf, dass das Sicherheitsnetz der Geldpolitik reissen könnte. In diesen Phasen schalten die Märkte dann plötzlich auf «Risk-off» (will heissen: riskante Anlagen werden liquidiert) und eine übertriebene Hektik macht sich breit, so wie wir dies 2016 mehrfach erlebt haben.
Die Notenbanken hätten es in der Hand, diese fatale Dominanz an den Märkten zu stoppen. Sie sollten einerseits die Grenzen ihrer Macht offenlegen. Und gleichzeitig noch aggressiveren Massnahmen wie dem Helikoptergeld (gemeint ist die Finanzierung von Staatsausgaben direkt via Notenpresse) abschwören.
Auf der andern Seite wäre etwas weniger Schwarzmalerei opportun. Damit könnten die Notenbanken zum Ausdruck bringen, dass sie auf die Regenerationskräfte der Wirtschaft vertrauen. Ohne Zweifel, die Finanzkrise von 2008 war ein gewaltiges Desaster. Doch acht Jahre später wollen wir uns nicht ständig gegen neue Katastrophen rüsten müssen – welche dann stets wieder abgesagt werden.
Albert Steck arbeitet seit 2007 bei der Migros Bank und ist verantwortlich für die Markt- und Produktanalyse. Er ist Autor der Finanzkolumne im Migros-Magazin sowie Blogger. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften, Politologie und Publizistik war er Journalist, unter anderem bei der «Bilanz». Im Jahr 2007 gewann er den Medienpreis für Finanzjournalisten.
Bisherige Texte von: Rudi Bogni, Adriano B. Lucatelli, Peter Kurer, Oliver Berger, Rolf Banz, Samuel Gerber, Werner Vogt, Walter Wittmann, Alfred Mettler, Robert Holzach, Thorsten Polleit, Craig Murray, David Zollinger, Arthur Bolliger, Beat Kappeler, Chris Rowe, Stefan Gerlach, Marc Lussy, Samuel Gerber, Nuno Fernandes, Thomas Fedier, Claude Baumann, Beat Wittmann, Richard Egger, Didier Saint-Georges, Dieter Ruloff, Marco Bargel, Steve Hanke, Andreas Britt, Urs Schoettli, Maurice Pedergnana, Stefan Kreuzkamp, Katharina Bart, Oliver Bussmann, Michael Benz und Peter Hody.
-
Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.91%
-
Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.18.9%
-
Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.27.69%
-
Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.07%
-
Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.43%