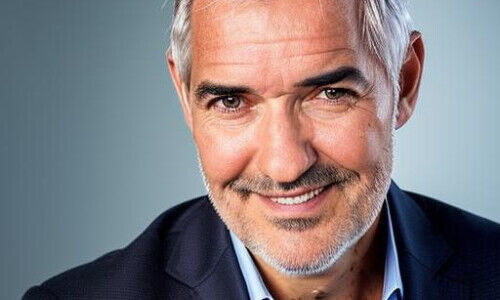Solange das Offshore-Banking in der Schweiz dominierte, spielte die Performance eine untergeordnete Rolle. Jetzt soll sich das ändern und die Schweiz ein Asset-Management-Zentrum werden. Eine Einschätzung von Werner E. Rutsch.
 Werner E. Rutsch ist Mitglied der Geschäftsleitung von AXA Investment Managers (Schweiz) und Co-Autor des 2008 erschienenen Buches «Swiss Banking – wie weiter?»
Werner E. Rutsch ist Mitglied der Geschäftsleitung von AXA Investment Managers (Schweiz) und Co-Autor des 2008 erschienenen Buches «Swiss Banking – wie weiter?»
Unlängst publizierte die «Neue Zürcher Zeitung» einen Kommentar zur Asset-Management-Initiative, die zum Ziel hat, die Schweiz als Zentrum für die institutionelle Vermögensverwaltung zu positionieren. Es lohnt sich, einige Punkte aus diesem Beitrag zu vertiefen und mit weiteren Gedanken zu vervollständigen.
Die Einschätzung, wonach die im Asset Management extrem wichtige Performance in der Vergangenheit hierzulande eine zu geringe Rolle gespielt habe, trifft sicherlich zu. Sie hängt aber eng mit der jahrzehntelangen Dominanz des Offshore-Banking zusammen, bei dem das Bankgeheimnis respektive der diskrete Schutz der Vermögen im Vordergrund stand und weniger deren Wertvermehrung.
Typisch schweizerische Geschäftskultur
Dass die Schweizer Finanzbranche nur mit Mühe eine Performance-Kultur entwickeln konnte, hat aber noch andere Gründe. Dazu gehört etwa die typische Schweizer Geschäftskultur. Sie ist und bleibt – wenn auch bisweilen durch die Globalisierung etwas verwässert – geprägt von einer starken Konsensorientierung, dem Bestreben nach Ausgleich und Harmonie und dem Vermeiden von Konfrontation.
Eine Kultur also, oft auch als Konkordanz (lat. Concordia: Eintracht) umschrieben, mit der die Schweiz in der Vergangenheit ja nicht schlecht gefahren ist. Aber: In diesem Umfeld ist es weitaus schwieriger, pointierte Meinungen durchzusetzen; etwa als Fondsmanager einen eigenen Ansatz zu fahren – möglicherweise gegen den Rest der Arbeitskollegen und entgegen der Marktmeinung.
Verpönte Shareholder-Aktivisten
Statt eigenständige Anlageentscheide zu fällen, ist vielmehr Benchmark-Orientierung angesagt. Gegenbeispiele, wie sie manche Beteiligungsgesellschaften liefern, werden an der Börse kaum belohnt. Solche Anlagevehikel sind zumeist mit einem Abschlag bewertet.
Verpönt ist auch der Shareholder-Aktivismus, wie ihn in den neunziger Jahren der Financier Martin Ebner hierzulande erstmals gegenüber der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) praktiziert hat. Mehr noch: Investor-Aktivisten wie der vor einigen Jahren unglücklich agierende Hedge Fund Laxey werden rasch einmal als institutiones non grata deklassiert.
Bloss ein Rohrkrepierer?
Die an sich gut gemeinte Idee, im Rahmen der Minder-Initiative die institutionellen Anleger zu mehr Engagement zu bewegen, dürfte sich unter anderem aus umsetzungstechnischen Gründen zum Rohrkrepierer erweisen. Das alles: Ein guter Nährboden für eine Performancekultur?
Ein weiterer gewichtiger Aspekt ist der unter institutionellen Anlegern weit verbreitete und bisweilen einseitige Kostenfokus. Nachdem im Glaubenskrieg zwischen den Anhängern von aktivem und passivem Management immer mehr die letztere Fraktion an Oberwasser gewinnt, steigt entsprechend auch der Kostendruck für die (aktive) Vermögensverwaltung.
Rendite nach Kosten
Der Schweizer Markt ist dadurch einer der kompetitivsten weltweit geworden; die Margen gehören hierzulande zu den tiefsten – auf den ersten Blick gut für die Versicherten. Anstatt den Fokus auf die «Rendite nach Kosten» zu legen, stimmen auch Aufsichtsbehörde und Politiker in dasselbe Lied ein.
Dabei sind die anno 2011 im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) ermittelten durchschnittlichen Vermögensverwaltungskosten von 0,56 Prozent bei institutionellen Anlegern durchaus eine akzeptable Grösse. Dass ein Privatanleger dieselben Leistungen angeblich zu einem ähnlichen Preis beziehen könnte, ist nicht nur Fantasie, sondern leider auch Irreführung. Ideale Voraussetzungen für eine Performancekultur?
Chance für Versicherungen
Abgesehen vom unbestrittenen Wunsch, das Entstehen und Entwickeln von Start-ups im Asset Management zu vereinfachen und zu fördern, muss noch ein weiterer Punkt erwähnt werden: Der Schweizer Finanzplatz lebt bekanntlich auch von den Versicherungen, und gerade für sie bieten sich Chancen, das Geschäftsfeld Asset Management zu revitalisieren.
Die Möglichkeit, die eigene Vermögensverwaltung mandantenfähig respektive externen Investoren zugänglich zu machen, dürfte sich allerdings kleineren Anbietern verschliessen – doch für die grösseren umso attraktiver sein.
Erfolgreiche Portfolio-Manager
Nicht einzusehen ist ferner, warum eine grosse autonome Pensionskasse nicht an diesem Wettbewerb teilhaben darf: Vielerorts gibt es sehr erfolgreiche Portfolio-Manager, von deren Erfolg aber ausschliesslich die angeschlossene Stiftung profitiert – im Markt der Sammelstiftungen dagegen wird man dazu noch mehr hören, dem ist gewiss.
-
Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.39%
-
Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.19.19%
-
Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.27.95%
-
Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.26%
-
Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.21%