Beat J. Guldimann arbeitete 14 Jahre für die UBS, zuletzt als CEO der Bank in Kanada. Seine Sicht hat er in einem Buch festgehalten. Ein Interview.
 Herr Guldimann, die UBS kommt kaum vom Fleck, das Bankgeheimnis wankt und die Schweiz gilt als Steueroase. Welches Image hat das Swiss Banking im Ausland?
Herr Guldimann, die UBS kommt kaum vom Fleck, das Bankgeheimnis wankt und die Schweiz gilt als Steueroase. Welches Image hat das Swiss Banking im Ausland?
Seit Jahren ein durchzogenes. Einerseits bewundert man den Erfolg der Schweizer Banken; andererseits wird der Begriff Swiss Banking konstant mit Steuerflucht, organisiertem Verbrechen und korrupten Diktatoren in Verbindung gebracht.
Warum ist das so?
Zum Teil ist es die Folge einer verpassten Chance, das Ausland über die Realitäten des schweizerischen Bankwesens zu informieren. Der Finanzplatz Schweiz hat in den vergangenen Jahrzehnten vor allem in Nordamerika zu wenig Informationsarbeit geleistet, um diesen allgegenwärtigen Vorurteilen entgegenzutreten. Das Debakel in den USA und in der EU macht es heute deutlich, wie sehr sich eine proaktive Politik über die vergangenen zwanzig Jahre ausbezahlt hätte. Die Schweiz steht vor einem Scherbenhaufen.
Sie haben selber viele Jahre zuerst beim Schweizerischen Bankverein, später bei der UBS gearbeitet. Warum gingen Sie weg?
Ich habe die UBS im Herbst 2001 verlassen, nachdem ich das Angebot der kanadischen Grossbank CIBC erhalten hatte, deren Division Global Private Banking» zu leiten. Die UBS wollte mich nach Ablauf meines fünfjährigen Einsatzes in Kanada zurück nach Zürich holen. Das Angebot in Toronto ermöglichte es meiner Familie und mir, in Kanada zu bleiben, was damals für uns sehr wichtig war. Heute arbeite ich selbständig als Berater in der Finanzbranche.
«Es fällt immer schwer, einem guten Kunden Nein zu sagen»
Was verleitet eigentlich einen Kundenberater dazu, jegliche moralische Bedenken zu ignorieren und verbotene Geschäfte zu tätigen?
Die einfachsten und naheliegenden Motive sind «greed and success», gepaart mit einer guten Dosis «catch me if you can».
Genauer, was hat letztlich manche UBS-Kundenberater dazu getrieben, in eine kriminelle Grauzone abzudriften?
Diese Frage müsste man den erwähnten Personen stellen. Von aussen betrachtet stehen zwei Gründe im Vordergrund: Zum einen fällt es vielen Kundenberatern immer wieder schwer, einem guten Kunden «Nein» zu sagen. Anders gesagt: Man stellt lieber einen Kunden zufrieden, als dass man interne Weisungen einhält. Zum andern hatte die UBS in den vergangenen Jahren sehr aggressive Ziele, die nur schwer zu erreichen waren.
Also ging es gar nicht anders, als sich in diese Grauzone zu bewegen?
Die UBS-Verantwortlichen wussten genau, dass manche Geschäftspraktiken, die in andern Ländern üblich waren, in den USA problematisch sein könnten. Wer sich in einer Grauzone bewegt, läuft Gefahr, sich darauf zu verlassen, dass man sich im schlimmsten Fall mit ein paar «legal opinions» aus der rechtlichen Unklarheit retten kann. Im Rückblick ist es so herausgekommen, dass die UBS im amerikanischen Niemandsland auf ein paar Landminen getreten ist.
«Man hat sich zu wenig damit befasst, wie gefährlich das Offshore-Banking ist»
Warum hat das Top-Management der UBS das alles toleriert?
Das müssten Sie die Herren Ospel, Rohner, Weil und Kurer fragen. Meines Erachtens hat man sich schlicht und einfach zu wenig damit befasst, wie gefährlich das Offshore-Banking mit amerikanischen Kunden ist. Ausserdem wurde die UBS nach der Akquisition von Paine Webber im Jahre 2000 aus amerikanischer Optik zu einer US-Bank. Dies führte zu einer neuen Verantwortung, die man vermutlich nicht voll und vor allem nicht frühzeitig erkannt hat.
Wie haben Sie Marcel Ospel im Lauf der Zeit erlebt?
Ich habe mit Herrn Ospel direkt nicht sehr viel zu tun gehabt. Wenn ich meinen Eindruck auf wenige Worte beschränke, dann würde ich ihn als einen sehr ambitiösen Mann beschreiben, der sich mehr auf den Erfolg konzentriert hat als auf das Risiko, das er dabei einging. Seine Karriere gab ihm recht – bis 2008.
Warum hat sich die US-Justiz so sehr in die UBS festgebissen?
Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen hatte die UBS das Pech, mit Igor Olenicoff einen Kunden zu haben, der dem IRS (US-Steuerbehörde) ins «dragnet» gelaufen ist und erst noch akribisch Bankdokumente aufbewahrte, die dem IRS bei einer Hausdurchsuchung in die Hände geraten sind. Dies hätte jeder andern Bank auch passieren können. Zum andern war die UBS seit der Akquisition von Paine Webber die einzige Schweizer Bank mit einer so massiven Präsenz in den USA.
«Einige tun es weiterhin, weitgehend unter dem Radar»
Haben denn nicht auch andere Banken vergleichbare Steueroptimierungs-Geschäfte betrieben?
Absolut. Und einige unter ihnen tun es weiterhin, weitgehend unter dem Radar.
Welche Überlebenschancen geben Sie Ihrer früheren Arbeitgeberin?
Wenn man davon ausgeht, dass die UBS heute an einem neuen Ausgangspunkt steht, dann hat sie durchaus gute Überlebenschancen – selbst wenn das etwas ironisch klingen mag. Die grossen Schweizer Banken haben bereits vor Jahren begonnen, im Ausland aktiv eine Onshore-Strategie zu fahren. Das war ein richtiger Entscheid, denn der Druck auf das traditionelle Offshore-Geschäft aus der Schweiz heraus wird weiter zunehmen.
Muss die UBS nicht erst noch schrumpfen, um überleben zu können?
Ich denke nicht, dass die Grösse das Hauptproblem ist. Die UBS ist bereits wesentlich kleiner als noch vor der Finanzkrise und hat heute ein völlig anderes Risikoprofil. Nun liegt der Erfolg in der Fokussierung auf gewisse Geschäftsaktivitäten. Dazu gehören wie gesagt das «onshoring» im internationalen Private Banking.
«Die UBS muss ihren ‹moral compass› neu richten»
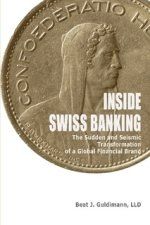 Was braucht es weiter, damit die UBS an die Erfolge von einst anknüpfen kann?
Was braucht es weiter, damit die UBS an die Erfolge von einst anknüpfen kann?
Die UBS muss ihren «moral compass» neu richten. Sie muss sich voll und ganz auf höchste Standards in der Kundenberatung konzentrieren und alles daran setzen, nur noch positive Schlagzeilen zu liefern. Ich habe viel Vertrauen in die Fähigkeit des Teams unter Oswald Grübel, die UBS wieder auf Erfolgskurs zu bringen.
Wie stark hat die UBS dem Finanzplatz Schweiz geschadet?
Die Zukunft wird zeigen, wie gross der Schaden ist. Dies wird weitgehend daran liegen, wie stark sich der Bundesrat und das Parlament auf die Wahrung der schweizerischen Souveränität konzentrieren, und wie stark sich der Bankensektor durch die Bankiervereinigung zu einer internationalen Imagekampagne bekennt. Es gibt in anderen Industrien genügend gute Beispiele, wie man das tun kann.
Sollte man die UBS nicht stärker zur Rechenschaft ziehen?
Ich würde in Frage stellen, ob man der UBS effektiv die Schuld am ganzen Debakel zuweisen kann. Wir haben es hier mit einer äusserst komplexen Situation zu tun, in welcher die UBS zweifelsohne kausal verantwortlich ist. Man muss aber alle Stakeholders gleichermassen zur Verantwortung ziehen. Dazu gehören auch die andern international tätigen Banken, die Bankenorganisationen und nicht zuletzt die Finanzmarktaufsicht und die Regierung.
«Dieser Druck kommt einer politischen Erpressung nahe»
Was könnten die künftigen Stärken im Swiss Banking sein, wenn das Bankgeheimnis nicht mehr denselben Schutz wie früher bietet?
Vorweg ist es wichtig, festzustellen, dass das Bankgeheimnis von jeher darauf ausgelegt war, nur legitime Interessen zu schützen. Kriminelle Aktivitäten fanden nie Schutz unter Artikel 47 des Bankengesetzes. Was sich in den vergangenen zwanzig oder dreissig Jahren geändert hat, ist unser Verständnis dessen, was legitim und was kriminell ist.
Könnten Sie das genauer herleiten?
Wir haben in den achtziger Jahren in der Schweiz Insider-Trading zu einem Strafbestand gemacht und neue Regeln im Bereich der Geldwäscherei eingeführt. Diese Neuerungen haben die Anwendbarkeit des Bankgeheimnisses bereits eingeschränkt. Nun tun wir Vergleichbares im Bereich der Steuergesetzgebung. Der Unterschied liegt darin, dass wir dies nun unter einem enormen internationalen Druck unternehmen, der einer politischer Erpressung nahe kommt.
«Der Zweck heiligt zurzeit alle Mittel»
Neu ist auch, dass manche Nachbarländer kein Problem damit haben, selber kriminell zu werden, um an vertrauliche Bankdaten heranzukommen. Der Zweck heiligt zurzeit alle Mittel; nicht nur für die USA, sondern offensichtlich auch für Deutschland. Momentan werden nicht nur im internationalen Banking neue Standards gesetzt, sondern auch im politischen Rechtsverständnis.
Welche «Messages» erwarten Sie aus Sicht des Auslands von den führenden Bankiers in der Schweiz?
Ausländische Kunden wollen mit Bankiers Geschäfte machen, die in voller Kontrolle ihrer Geschäfte sind, eine klare Vorstellung von ihrer Strategie haben und zum Finanzplatz Schweiz stehen. Die gegenwärtigen Entwicklungen stellen eine Chance dar, alte Geschäftsmodelle zu erneuern und die Strategie auf die nächsten fünfzig Jahre auszurichten.
«Im Ausland erwartet man Zusicherungen»
Es braucht auch die Einsicht, dass sich das internationale Private Banking in einem konstanten Wandel befindet. Im Ausland erwartet man die Zusicherung, dass das Vertrauen in die Schweiz und in ihre Bankiers auch in Zukunft gerechtfertigt ist. Ich persönlich wünschte mir, dass die Schweizer Banken im Rahmen einer internationalen Imagekampagne zu neuer Vertrauenswürdigkeit zurückfinden, koordiniert von der Schweizerischen Bankiervereinigung unter ihrem neuen Präsidenten.
 Beat J. Guldimann stammt aus dem Kanton Baselland. Er studierte Rechtswissenschaften und doktorierte 1986 an der Universität Basel. In der Folge arbeitete er in verschiedenen leitenden Stellungen in der Industrie und war während zwölf Jahren gleichzeitig im Stadtrat von Reinach BL.
Beat J. Guldimann stammt aus dem Kanton Baselland. Er studierte Rechtswissenschaften und doktorierte 1986 an der Universität Basel. In der Folge arbeitete er in verschiedenen leitenden Stellungen in der Industrie und war während zwölf Jahren gleichzeitig im Stadtrat von Reinach BL.
Im Oktober 1987 stiess er zum Schweizerischen Bankverein, wo er als Legal Counsel unter anderem mit der «Marcos-Affäre» betraut war. Im Januar 1997 wurde er mit dem Aufbau des Private-Banking-Geschäfts in Kanada beauftragt. Nach der Fusion von SBV und SBG war er für sämtliche Geschäfte der UBS in Kanada zuständig.
Im November 2001 wechselte Guldimann zur kanadischen Bank CIBC Wealth Management. Im Mai 2004 wechselte er in die Unternehmensberatung, und seit August 2007 führt er seine eigene Firma namens Tribeca Consulting Group.
Vor kurzem erschien «Inside Swiss Banking». Online-Bestellungen unter diesem Link.
-
Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.64%
-
Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.18.54%
-
Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.28.21%
-
Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.1%
-
Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.5%



































