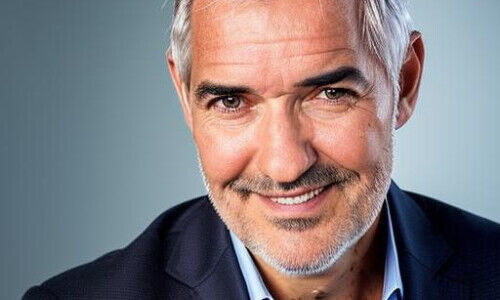Family Offices sind eine spannende Alternative für mürbe gewordene Private Banker. Hier werden die Vermögen der Allerreichsten verwaltet. Wer darin gut ist, kann sehr viel verdienen.
Sie sind die Domäne der Superreichen: Family Offices oder gleich Multi-Family-Offices. In diesen diskreten Unternehmen verwalten Familien ihre eigenen Vermögen – und öfters auch das Geld anderer Familien oder das von superreichen Individuen, UHNWI.
Hier wird nicht nur Geld verwaltet und investiert, Family Offices bieten komplexere Dienstleistungen an, zum Beispiel im Steuerbereich, in Erb- und Nachfolgeplanungen oder in der Philanthropie.
Komplexe Anforderungen
Die Anforderungen können sehr komplex werden, beispielsweise wenn die Bedürfnisse und Wünsche von Familienmitgliedern mehrerer Generationen berücksichtigt werden müssen, auch weil superreiche Familien meist über den ganzen Erdball verstreut leben.
Der Vorteil: Family Offices sind in der Regel viel schlankere Organisationen als Vermögensverwalter oder Privatbanken, die meisten Dienstleistungen sind an Banken oder Kanzleien ausgelagert.
Das heisst, Berater in Family Offices können sich auf das eine konzentrieren: Die Beratung – meist noch auf einem Spezialgebiet – eines einzelnen handverlesenen Kunden.
Namhafte Banker haben den Schritt gemacht
Kaum verwunderlich, dass angesichts des stark gestiegenen administrativen Aufwands, den Private Banker in Finanzinstituten inzwischen zu bewältigen haben, Jobs bei Family Offices hoch begehrt sind. Zudem befindet sich die Bankenbranche im permanenten Wandel, was die Arbeitsbedingungen nicht angenehmer macht.
Ein jüngeres Beispiel eines Bankers, der zu einem Family Office gewechselt hat, ist Andreas Ernst: Der langjährige Leiter Impact Investing bei der UBS arbeitet seit kurzem in Amsterdam bei Anthos. Das Institut gehört der Familie Brenninkmeijer, welche mit der C&A-Modekette zu Reichtum gekommen ist.
Marcel Kreis, langjähriger UBS-Banker und auch Chef für das Private Banking der Credit Suisse in Asien, ist Anfang dieses Jahres Verwaltungsratspräsident des Family Offices der australischen Myer-Familie geworden. Er ist zudem Verwaltungsrat im chinesischen Family Office Fusang.
«You eat what you kill»
Ein schlagendes Argument, für ein Family Office zu arbeiten, ist: Das Salär kann aufgrund der Branchengepflogenheiten locker in die Millionen gehen. In der Branche heisst es: «You eat what you kill», – «Du bekommst, was du erlegst».
Berater in Family Offices arbeiten unabhängig, jeweils mit einer eigenen Buchhaltung. Ihr Salär besteht im Gewinn, minus eines Vorschusses und der Ausgaben zulasten des Family Offices.
Dies mag sehr verlockend klingen, birgt aber auch erhebliche persönliche Risiken. «Es besteht viel weniger Raum, sich in solchen Organisationen zu verstecken als in grossen Finanzinstituten», sagt Matthias Schulthess, Mitgründer der Executive Search Boutique SchulthessZimmerman und Mitverantwortlicher für das Family-Office-Recruiting.
Antreten gegen globale Marken
Ähnlich wie im typischen amerikanischen Brokerage muss ein Family-Office-Berater seinen Vorschuss zunächst abarbeiten, bis er tatsächlich etwas verdient.
Einen weiteren Nachteil mag die sprichwörtliche Diskretion von Family Offices darstellen. Sie müssen in einem speziellen Kundensegment gegen globale Marken wie UBS, Citigroup oder HSBC antreten, während sie selber Bedrock, Sandaire oder Waypoint heissen. Bei den meisten Family Offices lässt sich anhand des Namens nicht feststellen, welche Familie hinter dem Geschäft steht.
Das ist gewollt – stellt für Berater, die Kundschaft akquirieren müssen, aber eine Hürde dar. Insbesondere in Asien, wo gerade die Marken der beiden Schweizer Grossbanken ein erhebliches Sogpotential für Neugeschäft haben.
Völlige Unabhängigkeit
Das bedeutet, dass Family-Office-Berater ihre eigene Marke entwickeln und der Grund für Neukunden sein müssen, eine traditionelle Bankbeziehung aufzugeben.
Neben spezialisierten Services ist insbesondere die völlige Unabhängigkeit eines Family Offices der Hauptgrund für einen Wechsel. Viel ist die Rede von verärgerten und desillusionierten Kunden, welche hohe Gebühren für schlechte Performances und teure Produkte bezahlen.
Doch stellt der Aufwand der Auflösung einer Bankbeziehung auch für sehr vermögende Kunden eine hohe Hürde dar – vor allem auch in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten.
Riesenschritt für einen Kunden
«Viele Kunden sind zwar von der Idee angetan, die Aufbewahrung ihrer Vermögen und die Beratung zu trennen,» sagt Schulthess. «Aber auch das Aufgeben einer Anlageexpertise von ausgewiesenen und globalen Bankenmarke zugunsten eines Family Offices ist für einen Kunden ein Riesenschritt.»
Family-Office-Berater müssen für eine erfolgreiche Akquise extrem viel in den Aufbau einer Kundenbeziehung investieren. Diese Anforderung trennt wiederum den Spreu vom Weizen unter den Beratern: Nur den wenigsten gelingt es, ihre Fachexpertise mit der Empathiefähigkeit, welche eine starke Kundenbeziehung bedingt, unter einen Hut zu bringen.
-
Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.44%
-
Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.19.15%
-
Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.27.91%
-
Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.24%
-
Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.26%