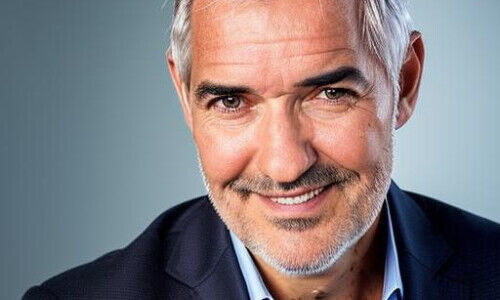Das Swiss Private Banking sucht zunehmend verzweifelt nach Wachstumsmöglichkeiten. Doch diese werden auch in den Boom-Märkten zunehmend rar, wie diese Analyse von finews.ch zeigt.
Zum Wachstum verdammt: Das Schweizer Private Banking kann sich einen Stillstand nicht leisten. Jedes einzelne Institut ist auf frisches Geld von neuen Kunden angewiesen, zumal die bestehende Kundschaft sich äusserst passiv verhält. Das Ertragsproblem zeigt sich anhand der öffentlich zugänglichen Resultate der Privatbanken zunehmend deutlich. Die Margen sinken, während viel Geld in IT-Infrastruktur, Digitalisierung, vor allem aber in Compliance investiert werden muss.
Es bleibt die Flucht nach vorne: Wachstum, um auf den teuren Plattformen Skaleneffekte erzielen zu können. Die Wachstumschancen sind allerdings zunehmend schwieriger zu erarbeiten. Die Entwicklungen in den einzelnen Marktregionen spielen den Privatbank nicht in die Hände – im Gegenteil, wie hier gezeigt wird.
1. Schweiz: Treten am Ort
Die Schweiz gilt – in einer Art Rückbesinnung in der post-Offshore-Banking-Ära – zwar bei praktisch allen Schweizer Privatbanken als Wachstumsmarkt. Doch die Realität ist: In Ermangelung realen Wachstums neuer Kundenvermögen müssen die Banken ihre Marktanteile erhöhen oder Konkurrenten übernehmen.
Beides ist kein leichtes Unterfangen, wie jüngst wieder das Beispiel der Notenstein Privatbank zeigt. Organisches Wachstum zeigt das Institut seit geraumer Zeit keines, obwohl es sich voll auf den Schweizer Markt konzentriert. Die Konkurrenz ist nicht nur wegen der Platzhirsche UBS und Credit Suisse extrem hart.
Privatbanken wie Notenstein müssen auch gegen die regional hervorragend verankerten Kantonalbanken antreten, die das Wealth Management ebenfalls verstehen. Eine Akquisitionsstrategie zu vollführen, ist schwierig in die Praxis umzusetzen, wenn geeignete Übernahmekandidaten fehlen. Erstens braucht es verkaufswillige Institute, zweitens passt die Struktur der Kundenbücher und Marktregionen meist nicht vollständig zur eigenen Strategie, sodass unerwünschte Assets einen weiteren Käufer brauchen.
Das ist einer der Gründe, warum die Konsolidierung im Schweizer Private Banking eher schleppend verläuft, sich Wachstumschancen nur punktuell ergeben und diese dann heiss umkämpft sind.
2. Asien-Pazifik: Risse im Banking-Paradies
Das Versprechen zweistelliger Wachstumsraten hat in eine ganze Reihe von Schweizer Wealth Managern dazu bewogen, die hohen Kosten für den Aufbau einer Präsenz im Asien-Pazifik-Hub Singapur zu schultern.
Beratungsfirmen wie McKinsey ordnen Asien-Pazifik weiterhin deutlich mehr Wachstumspotenzial zu als anderen hier vorkommenden Private-Banking-Regionen, weshalb Schweizer Banken hier weiterhin viel investieren.
Doch die letzten Quartale haben gezeigt, dass dort die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen. Mit den zunehmenden und weiter anhaltenden Marktturbulenzen ist die asiatische Kundschaft deutlich zurückhaltender und risikoaverser geworden, was sich auf die Private-Banking-Erträge deutlich auswirkt.
Zudem haben sich in der Region mehrere Brandherde entwickelt, wie finews.ch festgestellt hat. An erster Stelle ist der Skandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB zu nennen, der Schockwellen von Singapur bis an den Zürcher Paradeplatz ausgesandt hat. Die Folgen dürften steigende Compliance- und Risikomanagement-Kosten sein.
Zudem stehen zahlreiche Staaten in Asien in Verhandlungen mit der Schweiz wegen des Austauschs von Steuerinformationen. Indien und Malaysia sind hier an vorderster Front, Sri Lanka, Pakistan und die Philippinen stellen ebenfalls Forderungen.
Für das Offshore-Zentrum Singapur mit den Schweizer Banken im Mittelpunkt bedeuten diese Entwicklungen nichts Gutes.
3. Europa: Säen auf verbrannter Erde
In den 1970er-Jahren gehörte es in Europa zum guten Ton, seinen Notgroschen bei einer Schweizer Privatbank anzulegen. Oft genug, ohne dass der Steuervogt davon wusste. Entsprechend war der Alte Kontinent mit Abstand der bedeutendste Markt fürs Swiss Private Banking – bis der Steuerstreit sowohl das Bankgeheimnis wie auch das tradierte Steuervermeidungs-Geschäft aus den Angeln hob.
Seither halten die Abflüsse von europäischen Kundengeldern an. Ebenso sehen sich heisige Banken weiter dem Druck ausländischer Behörden ausgesetzt, wie letztens eine Datenanfrage Frankreichs bei der Grossbank UBS zeigte.
Dennoch ist Europa für Schweizer Private Banker keineswegs verbrannte Erde. Laut einer Studie der Beratungsfirma McKinsey wuchsen letztes Jahr die Vermögen reicher Europäer mit 4 Prozent schneller als die Wirtschaft in der Region. Das stärkste Wachstum kommt dabei aus Grossbritannien, Deutschland und Skandinavien – und der Schweiz.
Gleichzeitig zeigt sich, dass der Übergang von der Schwarz- zur Weissgeld-Strategie und von Offshore- zum Onshore-Geschäft allmählich Früchte trägt. So schrammte die Vermögensverwaltung der UBS Deutschland letztes Jahr haarscharf an den schwarzen Zahlen vorbei. Häuser wie Julius Bär und Vontobel machen im grössten europäischen Markt ebenfalls Boden gut.
Regulatorische Bemühungen um einen besseren Marktzugang und Projekte wie die UBS-Europa-Bank zeigen denn auch, dass das Swiss Banking Europa noch längst nicht aufgegeben hat. Ein Wachstumsmarkt wird der Alte Kontinent so schnell nicht mehr. Aber immerhin birgt er das Versprechen von stabilen und unbelasteten Erträgen.
4. Osteuropa: Eiszeit im Boom-Markt
Noch im hohen Alter reiste der inzwischen verstorbene Hans Vontobel ins entlegene Kasachstan; die boomenden Osteuropa-Märkte waren dem Zürcher Banken-Doyen ganz offensichtlich eine Reise wert.
Mit dem Ukraine-Konflikt und den damit einhergehenden Sanktionen gegen Politiker und Oligarchen ist aber insbesondere Russland zum heissen Pflaster für Schweizer Banken geworden. Zudem machen neue Steuertransparenz-Regeln das Geschäft mit reichen Russen und deren verschachtelten Vermögen schwer. Hinzu kommt noch der Zerfall des Ölpreises, der zahlreichen Produzenten in der Region schwer zusetzt.
Damit ist über das Boom-Geschäft, in dem Kundenberater einst mit Gold aufgewogen wurden, eine Eiszeit hereingebrochen.
Das zeigt sich etwa am Beispiel der Credit Suisse (CS), traditionell die Schweizer Privatbank mit dem grössten Osteuropa-Geschäft. Die Grossbank sieht sich in einen Skandal um die verschwundenen Millionen eines georgischen Oligarchen verwickelt. Wie auch finews.ch berichtete, verabschiedete sich die CS zudem letzten Juli überraschend vom Onshore-Geschäft in Russland.
5. Lateinamerika: Das «zweite Europa»
Als Wachstumsregion war Lateinamerika für Schweizer Privatbanken zuletzt eher eine Enttäuschung. Das ehemalige Wachstumszugpferd Brasilien lahmt seit geraumer Zeit, die Entwertung des Reals wirkt sich auch auf die Entwicklung der Kundengelder aus. Noch ungemütlicher ist die Lage durch die Einführung sogenannter Steuerregulierungsprogramme geworden, namentlich in den grössten Private-Banking-Märkten Brasilien, Argentinien und Mexiko.
Diese Länder bieten ihren Bürgern an, unversteuerte Gelder zu repatriieren oder sie nachträglich zu versteuern und eine geringere Busse zu bezahlen. Julius Bär bekam dies im ersten Halbjahr 2016 besonders zu spüren, CEO Boris Collardi sprach von einem «zweiten Europa» in Anspielung auf die diversen europäischen Regularisierungsprogramme, die nach wie vor für Geldabflüsse sorgen.
Nach den USA und Europa hat es das Schweizer Private Banking nun mit lateinamerikanischen Steuerprogrammen zu tun bekommen.
6. Naher Osten: Die Ölflaute
Die Wachstumsstory Naher Osten hat einen Haken: Sie hängt am Ölpreis. In den Förderstaaten ist in den vergangenen Jahrzehnten eine äusserst vermögende Klientel entstanden, die seit geraumer Zeit auf dem Radar Schweizer Wealth Manager steht. Doch auch in dieser Region hat sich der Kampf um die wohlhabende Klientel zugespitzt. In den Finanzzentren wie Dubai drängeln sich die Wealth Manager aus der Schweiz wie auch aus anderen Ländern.
Der grosse Dämper ist aber der Ölpreis, der sich binnen zwei Jahren mehr als halbiert hat. Eine Besserung ist Prognosen zufolge nicht in Sicht. Die Folgen sind teilweise ersichtlich: Kunden im Nahen Osten mussten teilweise aus Liquiditätsgründen Geld abziehen, andere haben ihre Portfolios «deleveraged», das heisst, sie haben Kredite zurückbezahlt und Risiken reduziert. Das sind Entwicklungen, denen Private Banker nur zuschauen können.
7. USA: Nur noch eine Nische
Der Private-Banking-Markt in den USA ist der weltweit grösste und entsprechend äusserst hart umkämpft. Und nach annähernd einem Jahrzehnt steuerlicher Auseinandersetzungen, Milliarden von Bussenzahlungen und eine Reihe von erzwungenen Bankschliessungen sind die USA für das Schweizer Private Banking verbrannte Erde.
Die UBS ist die einzige Schweizer Bank mit grossem Fussabdruck in den USA, doch kämpft sie seit ihrem durch die Übernahme des Brokers PaineWebber im Jahr 2000 erfolgten Markteintritt um die Verbesserung der Profitabilität. Die Credit Suisse vollzog einen vollständigen Marktaustritt, versucht derzeit aber wieder durch den Aufbau eines UHNWI-Geschäfts Fuss zu fassen.
Kleinere Institute wie Vontobel, Reyl und Syz haben Onshore-Präsenzen und hoffen, mit der Karte Swiss Banking reiche US-Kunden anzulocken. Insgesamt haben über 40 Schweizer Wealth Manager eine US-Onshore-Registrierung – doch der einst so verheissungsvolle US-Markt ist im Schweizer Private Banking zur Nische geworden.
8. Afrika: Kein Fuss am Boden
Afrika – und insbesondere das Sub-Sahara Afrika – gilt seit Jahren als Hoffnungsträger für das globale Wirtschaftswachstum, ergo auch für das Private Banking. Allein: Mit 54 anerkannten Staaten in völlig verschiedenen Stadien der wirtschaftlichen (und demokratischen) Entwicklung, ist das kontinentale Wachstum Afrikas eine äusserst heterogene Geschichte.
Kommt dazu, dass das effektive Potenzial für Private Banker vergleichsweise klein ist. Gemäss Capgemini leben auf dem afrikanischen Kontinent rund 150'000 HNWI, die zusammen rund 1,4 Billionen Dollar auf die Waage bringen. Zum Vergleich: Lateinamerika zählt 520'000 HNWI mit 7,4 Billionen Dollar, Asien-Pazifik 5,1 Millionen HNWI mit 17,4 Billionen Dollar Vermögen.
Die erfolgreichste Privatbank in Afrika, Investec, verwaltet dort rund 24 Milliarden Dollar. Darum ist auch klar, warum sich das Schweizer Private Banking eher nach Osten und Westen orientiert, denn gegen Süden. Von effektiven Afrika-Plänen ist nur bei der Falcon Private Bank etwas bekannt. Aber grosse Impulse sind vorderhand keine zu erwarten.
-
Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.4%
-
Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.19.2%
-
Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.27.95%
-
Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.24%
-
Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.21%