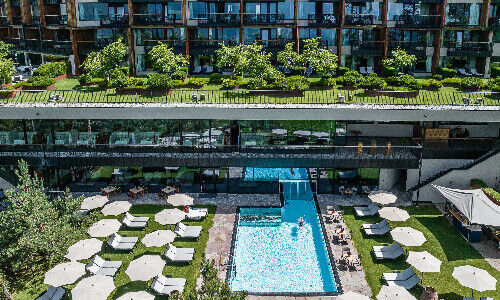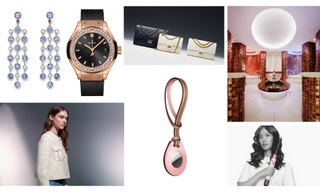Die extremen Anforderungen im Investmentbanking schrecken immer mehr Juniors ab. Alte Kämpen, die sich mit 130-Stunden-Wochen brüsten, halten diese für Weicheier. Sie scheinen vom heutigen Banking keine Ahnung mehr zu haben.
Seit im vergangenen Frühling Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs öffentlich gemacht haben, dass ihre physische und psychische Gesundheit aufgrund der regelmässig verlangten 100-Stunden-Wochen Schaden nimmt, findet in angelsächsischen Finanzmedien ein absurder Streit über die Notwendigkeit einer gesunden Work-Life-Balance für junge Investmentbanker statt.
Zudem überbieten sich die Finanzinstitute nun mit Einstiegslöhnen und anderern finanziellen Incentives, um im Talentekrieg die Überhand zu behalten. Die Credit Suisse (CS) zahlt jungen Analysten in ihrem ersten Berufsjahr einen sogenannten Lifestyle-Bonus von 20'000 Dollar.
Alles mit finanziellen Anreizen regeln
Darüber hinaus überprüft die CS derzeit die Entlöhnungsstruktur für Junioren in der Investmentbank. Die CS lege wie andere Banken auch hohen Wert auf die Rekrutierung und Bindung von Talenten, so ein Sprecher.
Goldman Sachs reagierte diesen Monat mit einer Erhöhung des Einstiegslohns von 85'000 auf 110'000 Dollar. Evercore will nun 120'000 Dollar bieten, andere Institute wie Guggenheim Partners oder Bank of America haben bereits zweimal die Saläre gesteigert. Auch die UBS macht mit: Sie erhöhte die Einstiegslöhne in der Investmentbank auf 100'000 Dollar und zahlte für Analysten und Associates einen einmaligen Bonus von 40'000 Dollar.
Der Bieter-Wettbewerb unter den Investmentbanken, zeigt überdeutlich die Zeichen einer Kultur, in der alles scheinbar mit finanziellen Anreizen geregelt werden kann.
Doch diese Anreize ziehen bei Universitätsabgängern immer weniger. Auch Jung-Banker wollen eine gesunde Work-Life-Balance. Sie seien bereit, auf einen Teil des Salärs zu verzichten und anstatt im Investmentbanking einen Job im Asset Management zu suchen, zitierte das Branchenportal «Financial News» (Artikel bezahlpflichtig) diese Woche eine alarmierte Londoner Headhunterin.
130 Stunden: Im Ernst jetzt?
Zuvor hatte «Financial News» Xavier Rolet zu dem Thema befragt. Rolet ist der ehemalige Chef der Londoner Börse und hat seine Karriere bei Goldman Sachs in New York lanciert – in den 1980er-Jahren. Rolet sagte allen Ernstes, 130-Stunden-Wochen seien zu seiner Zeit die Normalität gewesen. 130 Stunden in einer Woche, die 168 Stunden hat – da blieb Rolet jeweils nicht viel Zeit übrig für Elementares wie Essen oder Schlafen oder nur schon, um auf die Toilette zu gehen.
Rolet stimmte auch in den Kanon anderer altgedienter Investmentbanker ein, die bei den heutigen Jung-Bankern den «Schneid» vermissen. «Wenn sie der Meinung sind, dass sie zu hart arbeiten, dann sollten sie sich einen anderen Job suchen», sagte beispielsweise Howard Lutnick, CEO von Cantor Fitzgerald, in einem «Bloomberg»-Interview. Ex-Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein sagte, über eine Work-Life-Balance habe er bei seinem Berufseinstieg in den 1970er-Jahren nicht nachgedacht.
Abgangswelle droht
Rolet wiederum empfahl den Rekrutierern, «arme und hungrige» Universitäts-Absolventen anzustellen. «Wer meint, dass die langen Arbeitsstunden nicht zum gewünschten Lifestyle passen, sollte sich eine andere Tätigkeit suchen.»
Genau dies tun die Jung-Banker. Das Remote-Working während der Corona-Pandemie hat die Exit-Bewegung aus den Investmentbanken noch verstärkt. Diese stünden wegen ihren Arbeitsbedingungen vor einer riesigen Abgangswelle, sagte die Headhunterin.
Senior Banker wie Rolet, die dem Nachwuchs mangelnde Motivation oder fehlenden Durchhaltewillen vorwerfen, scheinen vergessen zu haben, dass das Banking zu ihrer Zeit in den 1980er-Jahren mit dem Banking wie mit den Finanzmärkten und der Wirtschaft im Allgemeinen von heute nicht mehr vergleichen lässt.
Produktivität ist heute doppelt so hoch
Sprich: Technologie- und Kommunikationssysteme in Echtzeit lassen auf Banker eine ununterbrochene Lawine von Informationen los und verlangen heute nach extrem kurzen Reaktionszeiten. Die Produktivität von Bankern hat sich in den vergangenen 40 Jahren mehr als verdoppelt – und so auch der Stress.
Die Finanzmärkte haben mit dem Aufkommen von Derivaten und Optionen ein Vielfaches an Komplexität gewonnen. Der Handel findet nun zwar elektronisch über Computersysteme statt, aber die Systeme und die fehlerhaften Informationen müssen fortdauernd überwacht, kontrolliert und gegengecheckt werden. Compliance und Risikomanagement waren vor vier Jahrzehnten im Banking noch Fremdwörter.
Fehlender Leistungswille wegen schlechten Bedingungen
Heute bedeuten diese Prozesse für die Banker in erster Linie administrativen Aufwand. Regulatoren, Auditoren und andere Berater und Prüfer sind Stammgäste in den Banken und verlangen ständig nach Informationen und Materialien, die mühselig aus den Systemen gezogen werden müssen. Ständige Reorganisationen, Restrukturierungen und Jobabbauten führen strukturell zu einer höheren Belastung für die Jungbanker, da Senior Banker den Kostensenkungen zum Opfer fallen.
Kurzum: Nicht die jungen Berufseinsteiger und ein ihnen unterstellter, mangelnder Leistungswille sind im Investmentbanking das Problem, sondern die deutlich veränderten Arbeitsbedingungen.