Banker kommen an die kürzere Leine
Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen führen zu einem Zustand, der dem ähnelt, der vor dem Fall der Berliner Mauer herrschte – so analysierte finews.ch bereits vergangenen Woche die Situation.
Der Konflikt reisst einen neuen Graben zwischen Russland und den Westen. Weil diese Kluft auf europäischem Gebiet verläuft, befördert sie auch die Entflechtung der Staaten in wirtschaftlicher, kultureller und politischer Hinsicht.
Credit Suisse: Neue Weltordnung
Wenn die Welt kleinteiliger wird, geht dies auch das Banking an. Denn die Branche gilt als Lebensader der Realwirtschaft, und kaum ein Sektor ist so global aufgestellt und so stark vernetzt wie dieser (siehe unten).
Für die Schweiz mit dem grössten Offshore-Finanzplatz der Welt gilt dies noch mehr. Das ist den Analyse-Abteilungen der hiesigen Banken wohl bewusst. So schrieb Michael Strobaek in einer Einschätzung der Lage von einer «neuen Weltordnung», die zunehmend multipolar aussehe. In diesem Umfeld sei das Management von Risiken wichtiger denn je, mahnte der oberste Investmentchef der Credit Suisse (CS).
Tatsächlich muss sich die Banker-Gilde dieser Tage besonders vorsichtig bewegen, hat doch der Ukraine-Konflikt Entwicklungen beschleunigt, welche die Spielregeln des Bankgeschäfts grundlegend verändern könnten.
1. Schreckgespenst einer Stagflation

(Bild: JJ Wing, Unsplash)
Der Konflikt der westlichen Industriestaaten mit Russland über den Einmarsch in der Ukraine dürfte auch hinter den Kulissen der Notenbanken für Hektik sorgen. Inwieweit werden weiter steigende Energie- und Rohstoffpreise einerseits die Inflation befeuern, und wie stark dämpft dies andererseits die Konjunktur?
Denn Russland ist nicht nur einer der weltweit grössten Öl- und Gasexporteure. Auch bei Stahl, Aluminium, Nickel, Zink und Zinn könnte eine Exportverknappung zu weiter steigenden Notierungen führen.
Inzwischen geht sogar das Schreckgespenst einer Stagflation um, also einer sich klar verlangsamenden Konjunkturentwicklung bei weiter stark steigenden Preisen. In einem solchen Szenario gerät die Geldpolitik in eine Zwickmühle. Wie weit kann man die Zinsen zur Inflationsbekämpfung anheben, ohne die Wirtschaft abzuwürgen?
Der Ukrainekrieg hat bereits bei den Schätzungen der Ökonomen dafür gesorgt, dass der erwartete Zinsschritt der US-Notenbank (Federal Reserve, Fed) im März nun überwiegend mit einer Anhebung um 25 Basispunkte gesehen wird. Kaum jemand rechnet noch mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte.
Dabei hätten die jüngsten Zahlen zu Preisentwicklung, Konjunktur und Arbeitsmarkt in den USA eher Argumente für einen grösseren Schritt geliefert. Bei der Bank of England (BoE) wird bald die dritte Zinsanhebung in Folge erwartet, während die Europäische Zentralbank (EZB) erst zum Jahresende nachziehen dürfte. Dann könnte es auch für die Schweizerische Nationalbank (SNB) Zeit werden, hierzulande die Zinswende einzuläuten.
2. Reichlich Arbeit für die Regulatoren

(EZB, Bild: cmophoton.net, Uusplash)
Steigen weltweit die Risiken, ruft dies umgehend die Wächter auf den Plan – dies zeigt sich erneut mit der Eskalation der Ukraine-Krise. So hat die EZB dieser Tage und angesichts der Situation, europäische Banken mit einem Russland-Engagement einem Stresstest unterzogen. Gefordert sind nun auch die Finanzaufseher in westlichen Ländern, das korrekte Einhalten der Sanktions-Massnahmen im Auge zu behalten.
Bei diesen kurzfristigen Einsätzen dürfte es nicht bleiben. In einer unsichereren Welt mit schwächelnder Konjunktur wird wohl rasch der Ruf erklingen, systemrelevante Finanzdienstleister besser abzusichern.
Nachdem die Banken-Lobby zuletzt die Diskussion um zusätzliche Kapitalisierungs-Vorgaben erfolgreich ausgebremst hatte, werden diese Forderungen wohl wieder an Gewicht erhalten. Ebenfalls dürfte die Abwehr von Geldwäscherei zum Megatrend schlechthin werden – was manche Gebiete der Welt zu «No go»-Zonen (siehe unten) für das Banking machen würde.
3: Krypto – das dezentrale Denken wird schwierig
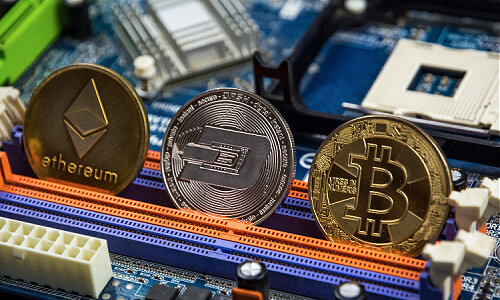
(Bild: Bermix Studio, Unsplash)
Der toxische Mix aus Zinswende, rezessiven Tendenzen und Polit-Risiken setzen den Börsen zu. Besonders unter die Räder kommen nun jene Anlagen, deren Preise durch viel «heisses Geld» bis Ende 2021 in die Höhe getrieben wurden. Sinnbildlich dafür stehen digitale Coins und Token, die seit vergangenem November ein Drittel an Wert eingebüsst hatten und nun weiter an Wert verlieren. Dies, obwohl Krypto-Fans gerade mit der geringen Abhängigkeit der Assets von der Börsenlage warben und diese als «sichere Häfen» propagierten.
Einigen Pionieren der Szene, wie dem in Moskau geborenen Ethereum-Gründer Vitalik Buterin, ist dies sogar recht. Er zeigte sich jüngst froh, dass sich die Spekulanten verabschiedeten. Allerdings zeichnet sich immer deutlicher ab, dass die digitalen Assets zum «Mainstream» werden; das bringt mehr Volumen, wird aber auch eine verstärkte Regulierung nach sich ziehen.
Damit entfernen sich die Anlagen mit hohem Tempo von der Idee, die einst bei Bitcoin & Co. Pate stand: Die Gründer strebten nach einem alternativen Finanzsystem, das dezentral und ohne einzelne mächtige Akteure funktioniert. Ist es Zufall, dass jenem Gedanken in einer von neuen Gräben und Machtblöcken geprägten Welt der Schnauf ausgeht?
4. Swift oder die Furcht vor der totalen Entflechtung

(Bild: Shutterstock)
Das Banking gilt als Lebensader der Realwirtschaft, entsprechend ist kaum eine andere Branche so global aufgestellt und so stark vernetzt wie diese. Eines der wichtigsten Netze des Sektors, das Informationssystem für Geldübermittlung Swift, ist nun zur «nuklearen Reaktion» des Westens im Ringen mit Russland avanciert.
So werden diese Woche diverse Staaten die russischen Banken von Swift abhängen und das Land damit von Finanzgeschäften isolieren. Am System hängen Finanzinstitute aus mehr als 200 Ländern, die täglich über 40’000 Nachrichten untereinander austauschen. Diese Sanktion wird Russland zweifelsohne treffen; es fragt sich indessen auch, was die Auswirkungen für (Schweizer) Banken sein werden, die bislang intensiv mit Osteuropa respektive mit Russland Geschäfte abwickelten.
5. «Suisse Secrets» mit unheimlichem Timing

(Bild: Hauptsitz der Credit Suisse am Paradplatz, Zürich (Bild: zVg)
Dass die «Suisse Secrets»-Enthüllungen um ein mysteriöses Datenleck bei der CS und die neuerliche Sanktionswelle gegen Russland nur wenige Tage aufeinander folgten, ist blosser Zufall. Nachdem aber alle Welt nun erfahren hat, dass in der Vergangenheit auch Kriminelle und Potentaten bei der zweitgrössten Schweizer Bank ihr Geld in Sicherheit wussten, steht der Offshore-Finanzplatz unter besonderer Beobachtung.
Mit Blick aufs Ausland werden die Schweizer Banken wohl versuchen, die (russische) Klientel so schnell wie möglich loszuwerden. Denn mit der EU und den USA, welche die Sanktionen gegen Russland anführen, haben die Institute schon im Steuerstreit Bekanntschaft gemacht. Gekostet hat dies die Branche Milliarden von Franken.
6. Schweizer Banken jenseits von Afrika

(Bild: Shutterstock)
Russland, das auf absehbare Zeit zur «No go»-Zone für Schweizer Banker werden dürfe, ist dabei nur das Extrembeispiel für das Dilemma, dass sich für den Offshore-Standort zunehmend abzeichnet.
Wird die Globalisierung zurückgedrängt und die Welt insgesamt risikoreicher, müssen sich die Institute noch viel genauer überlegen, in welchen Weltgegenden sie geschäften wollen. Sparprogramme fallen dabei wohl zunehmend mit Compliance-Abwägungen zusammen.
Diverse «strategisch» begründete Arrondierungen sind bereits zu beobachten. So hat sich die CS bereits aus diversen Märkten in Afrika zurückgezogen, während die Privatbank Julius Bär die Mehrheit an einem mexikanischen Vermögensverwalter veräussert hat. Die Grossbank UBS will sich auch aus weiteren Geschäften und Märkten verabschieden. Bislang erfolgte der Rückzug in Europa – so aus Österreich und Spanien.
7. Private Banker bleiben ganz zuhause

(Bild: Shutterstock)
Es klingt nach neuer Freiheit: Im März treten bei führenden Schweizer Vermögensverwaltern und Banken Arbeitsmodelle inkraft, welche die Erfahrungen und Forderungen aus der Corona-Pandemie berücksichtigen. Zwei Tage Fernarbeit pro Woche werden die Mindestregel sein für auf Vollzeit beschäftigte, wie finews.ch unlängst berichtete. Bei der CS wiederum ist es theoretisch möglich, überhaupt nicht mehr im Büro zu erscheinen. Das wäre dann die totale Flexibilisierung.
Sinnigerweise könnte dies aber dazu führen, dass sich die Bankerinnen und Banker noch mehr in ihr nächstes Umfeld zurückziehen. «Cocooning» heisst der Trend, der während der Corona-Krise (notgedrungen) Fahrt aufnahm – Hauskäufe in ländlichen Regionen boomen seither, Innen- und Garteneinrichtung wurden zu neuen Statussymbolen.
Wie der Rückzug in den selbstgewählten «Kokon» und das weltgewandte Private Banking von vor der Pandemie zusammenpassen, muss sich erst noch weisen.

























































