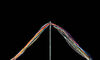Die Schweizerische Bankiervereinigung fordert eine rasche Annahme der Finanzdienstleistungs-Gesetze Fidleg und Finig. Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes, kritisiert dieses Ansinnen harsch.
Von Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes (sgv) und FDP-Nationalrat (ZH)
Ohne Rücksicht auf die Anleger und die KMU-Wirtschaft will die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) die Finanzdienstleistungs-Gesetze Fidleg und Finig durchs Parlament drücken. Doch dieses Regulierungspaket verdrängt die kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) aus dem Finanzplatz und erschwert den Zugang von KMU und Privatanlegern zu Finanzdienstleistungen.
Darum verurteilt der Schweizerische Gewerbeverband diesen Angriff auf die KMU-Wirtschaft. Ein seriöser und fundierter Gegenvorschlag liegt auf dem Tisch. Fidleg und Finig braucht es nicht.
Sämtliche Alarmglocken läuten
Die Banken sind die Nettonutzniesser der Grossgesetze Fidleg und Finig. Alle anderen, insbesondere die KMU, sind die Verlierer. Mit massivem Lobbying versucht die SBVg, die Gesetze trotzdem durchzudrücken. Den KMU – ihren Kunden – sprechen die Banken die Mitgestaltung der Gesetze ab.
Da läuten sämtliche Alarmglocken: Wissen denn nur Bankiers, was gut ist für unser Land? Dürfen nur Bankiers der Politik sagen dürfen, wie der Finanzplatz zu regulieren ist? Sind nur Bankiers in der Lage Fidleg und Finig zu beurteilen? Das ist schon sehr kurios. Sind es etwa die gleichen Bankiers, die sich vom Staat retten liessen? Sind es die Bankiers, die mit möglichen Schuldsprüchen in den USA konfrontiert sind? Und mit Bezug auf Fidleg und Finig: Sind es die Bankiers, die als einzige einen Nutzen aus der Regulierung ziehen?
Mehr als überheblich
Diese Haltung der SBVg ist mehr als überheblich. Sie zeigt, wie wenig sich die Bankiers um ihre Kunden, namentlich um die KMU, kümmern. Und das ist selbst schon ein Anzeichen dafür, wie weit Teile vom Finanzplatz von der Schweizer Wirklichkeit entfernt sind. Wenn nur noch das Auslandsgeschäft zählt und man bereit ist, ihm alles unterzuordnen, dann sind die Banken keine Schweizer Banken mehr. Aber vormachen sollte man sich nichts. Denn schon viel wurde dem Auslandsgeschäft geopfert: Das Bankgeheimnis, die Steuerintegrität oder etwa bestimmte Formen der Bargeldbenützung.
Fidleg und Finig reihen sich in diese Liste ein. Das Opfer müssen in diesem Fall die Kunden erbringen. Fidleg und Finig wird KMU und Privatanlegern den Zugang zu Finanzdienstleistungen erschweren. Statt Beratungsleistungen erhalten diese künftig nur noch die Risiken und Kosten übertragen. Und sie werden mit zusätzlichen Regulierungskosten von etwa 300 Millionen Franken im Jahr konfrontiert. Und wenn die Kunden reklamieren oder gar einen Gegenvorschlag machen, geben sich die Bankiers empört. Das ist partikularistische Profiteuren-Politik pur.
Wenig Argumente für Fidleg und Finig
Dabei gibt es nur wenig, dass für Fidleg und Finig spricht. Was ursprünglich als Querschnittsgesetz gedacht wurde, soll nun nur reduziert gelten. Banken und Versicherungen würden beispielsweise ihre eigenen branchenbezogene Gesetze behalten – was auch richtig ist. Warum sollten dann Fidleg und Finig überhaupt bestehen bleiben? Warum nicht auf die viel verhältnismässigere und kostengünstigere Selbstregulierung aufbauen?
Oder branchenspezifische Regulierungen erlassen, zum Beispiel ein Vermögensverwaltungs-Gesetz? Oder gar eine freiwillige Regulierung für jene Finanzinstitute einführen, die ein Auslandsgeschäft wollen?
Bankiers bleiben Antwort schuldig
Auf diese Fragen bleiben Bankiers – und das Eidgenössische Finanzdepartement – eine Antwort schuldig. Es sei betont: Der Schweizerische Gewerbeverband bekennt sich zu hohen Standards beim Kundenschutz und zu einer griffigen Aufsicht der Finanzdienstleister. Das erreichen wir aber mit dem Gegenvorschlag des Gewerbes besser als mit Fidleg und Finig.
Dass sich die Bankiers und ihre Vereinigung für ihre partikulären Interessen einsetzen, ist nicht erstaunlich. Was aber erstaunt und beunruhigt: Nicht nur sind sie offenbar willens, ihre Kosten den Kunden zu überwälzen, sondern sprechen zeitgleich diesen Kunden ein Meinungsäusserungsrecht ab.
Langfristig nicht sinnvoll
Nicht nur sind die Bankiers nicht an der Verhältnismässigkeit ihrer bejubelten Regulierung interessiert, sondern sie blocken konsequent jede Diskussion über Alternativen ab. Anstatt gegen ihre Kunden zu arbeiten, wären die Banken gut beraten, diesen zuzuhören und deren Vorschläge seriös zu prüfen. Denn Gesetze, die den eigenen Kunden schaden, können langfristig auch für die Banken nicht sinnvoll sein.
-
Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.62%
-
Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.18.56%
-
Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.28.24%
-
Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.09%
-
Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.48%