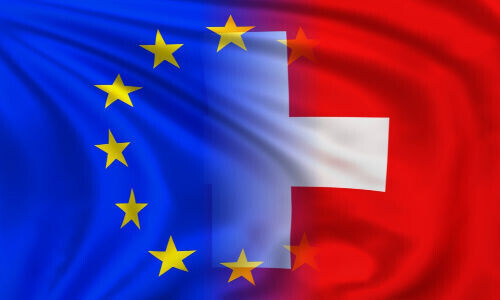EU droht Marktzugang auch für Schweizer Banken zu erschweren
In der EU wird an der Vereinheitlichung der nationalen Vereinbarungen gearbeitet, die den Zugang zum Binnenmarkt für Nicht-EU-Banken regelt. Das dürfte vor allem ein harter Schlag für die Banken in London sein, die auf diese Vereinbarungen angewiesen sind, um weiter Zugang zum EU-Markt zu haben, wie die «Financial Times» (Artikel bezahlpflichtig) am Montag berichtet.
Über die EU-Passportregelung bieten aber auch viele Banken aus der Schweiz, den USA oder Asien ihre Dienstleistungen und Produkte in EU-Ländern an. Eine entsprechende Verschärfung würde also auch den hiesigen Finanzplatz treffen.
Zwang zu stärkerer Regulierung
Der Vorschlag würde fast alle grenzüberschreitenden Verkäufe aus Nicht-EU-Ländern in den Binnenmarkt der Union unterbinden, heisst es in dem Bericht. Die Banken sind sehr an einem grenzüberschreitenden Zugang zur EU interessiert, da es billiger und einfacher ist, einige Geschäfte von ihren wichtigsten internationalen Zentren aus zu tätigen, anstatt Kapital und Personal zu verlagern.
Ziel der EU sei es, die Tätigkeit globaler Banken in der EU einzugrenzen und sie dazu zu bewegen, ihre Niederlassungen in stärker regulierte Tochtergesellschaften auf EU-Boden umzuwandeln. Gleichzeitig sollen die nationalen Aufsichtsbehörden der Einzelstaaten mehr Kompetenzen erhalten.
Ein Dorn im Auge
Den Beamten der Europäischen Zentralbank (EZB) ist die gestiegene Inanspruchnahme nationaler Regelungen und Ausnahmeregelungen für grenzüberschreitende Geschäfte nach dem Brexit offenbar ein Dorn im Auge. Die Neufassung sei Teil der Eigenkapital-Richtlinie der Europäischen Kommission, die den neuesten globalen Eigenkapitalstandards für Banken eine Rechtsgrundlage geben und die Diskrepanzen zwischen den verschiedenen nationalen Regulierungsbehörden beenden soll.
Die Richtlinie muss noch vom Europäischen Parlament und vom Europarat verabschiedet werden.
Lizenzabkommen hinfällig
Mit der geplanten Neufassung würden eine Reihe von bestehenden Lizenzabkommen hinfällig, wie es weiter heisst. Die Brüsseler Vorschläge würden die allgemeine Anforderung der bestehenden EU-Vorschriften verschärfen, dass Nicht-EU-Banken entweder eine Zweigstelle oder eine juristische Person in einem Mitgliedstaat haben müssen, in dem sie Geschäfte machen wollen.
Nach zähen Verhandlungen der Schweizer hatte Deutschland im Sommer 2015 die erleichterte Freistellung für Schweizer Finanzdienstleister erlaubt; der einfachere Marktzugang zum nördlichen Nachbarland für hiesige Anbieter könnte nun gefährdet sein.
Ein Billionen-Geschäft
Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) sagte dazu der «Financial Times», dass «die Gewährung des grenzüberschreitenden Marktzugangs für Schweizer Finanzinstitute in der EU zu offenen und integrierten Märkten beiträgt und daher im Interesse der EU-Investoren und damit letztlich im Interesse der EU ist». Das Europäische Parlament und der Rat der EU könnten die neuen Regeln wiederum ändern, fügte die SBVg hinzu. «Wir werden die möglichen Auswirkungen der Vorschläge gemeinsam mit unseren Mitgliedern sorgfältig analysieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es verfrüht, sich eine endgültige Meinung zu bilden.»
Das ist eine sehr zurückhaltende Aussage angesichts des Geschäfts, das hier auf dem Spiel steht: Laut SBVg betreuten hiesige Banken Ende 2019 Vermögen von EU-Kunden in der Höhe von rund 1’000 Milliarden Franken. Rund 20‘000 Bankmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind in diesem Bereich tätig. Das Business generiert in der Schweiz jährlich Steuern und Abgaben von rund 1,5 Milliarden Franken.
Beziehungen Schweiz-EU auf Tiefpunkt
Mit dem Abbruch der Verhandlungen zum Institutionellen Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU im vergangenen Mai ist auch eine Regelung des Marktzugangs für Schweizer Banken in weiter Ferne gerückt. Die Beziehungen zwischen Bern und Brüssel sind seit Abbruch der Gespräche durch die Schweiz auf einem Tiefpunkt angelangt. Auch die Zahlung der Kohäsions-Milliarde hat daran wenig geändert. Von der Schweiz als grosszügiges Zeichen des guten Willens betrachtet, wurde es von den EU-Vertretern eher als längst überfällige Begleichung einer Schuld gesehen.
Beim jüngsten Besuch von Aussenminister Ignazio Cassis in Brüssel war die Botschaft klar: Die EU erwartet, dass die Schweiz Vorstellungen dazu entwickelt, nach welchen Prinzipien man die Beziehungen zur Union führen will. Doch scheint man dazu in Bundesbern derzeit noch nicht in der Lage zu sein. Damit stehen auch Forschungskooperation und Börsenäquivalenz weiter in Frage.
Demgegenüber hatten sich die Schweiz und Grossbritannien nach dem Brexit bilateral angenähert und die Kooperation zwischen den beiden rivalisierenden Finanzplätzen verstärkt.