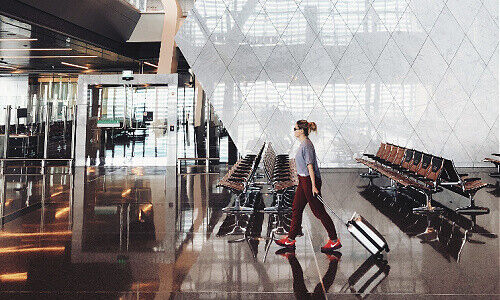Arbeiten von überallher: Die neuen Nomaden der Bankbranche
Wollen oder können – das ist hier die Frage. Brian Chin, der oberste Investmentbanker der Credit Suisse (CS) in New York, möchte seine Mitarbeitenden nach einem Jahr Corona-Massnahmen endlich ins Büro zurückholen. Denn er befürchtet, dass sie zu Hause ausbrennen und es ein Limit gebe für all die Zoom-Sitzungen, die man den Leuten mittlerweile zumute.
Das ist seine Sichtweise. Die andere ist die, dass viele Banker nach Monaten zu Hause gar nicht mehr zurück ins Büro wollen. Die Arbeitsprozesse sind mittlerweile bestens eingespielt, und zu sehr haben sich die Leute an die Flexibilität und die Freiheiten gewöhnt, die das Homeoffice bietet.
Noch nie im Büro gewesen
Anders präsentiert sich der Fall eines Schweizer Bankangestellten, der hier nicht namentlich genannt werden möchte. Er übernahm die Leitung der Zürcher Repräsentanz eines US-Vermögensverwalters im vergangenen Juni. Seit seinem Amtsantritt vor nunmehr neun Monaten hat er sein Büro noch nie betreten. Seine Kollegen kennt er bisher nur virtuell.
Er würde viel darum geben, wenn sich diese Situation bald ändern würde, sagt er im Gespräch mit finews.ch. Doch so schnell wird das kaum der Fall sein. Viele Finanzinstitute sind noch weit davon entfernt, ihre Mitarbeitenden im grossen Stil wieder ins Büro zu holen – zu unsicher ist die Situation – ein überstürzter Entscheid könnte fatale Folgen haben. Ausserdem ist Homeoffice auf längere Sicht auch eine Möglichkeit, hohe Kosten für Büroräumlichkeiten einzusparen.
Arbeitsmodelle haben ausgedient
Unter diesen Prämissen befindet sich die Finanzwelt im wohl grössten Wandel seit der Einführung des Computers vor rund 50 Jahren. Auslöser dafür sind diesmal aber keine branchenspezifischen Entwicklungen wie die Konsolidierung, neuartige Finanzprodukte, wechselnde Kundenbedürfnisse oder schärfere Bestimmungen und Vorschriften.
Es ist vielmehr die Erkenntnis, dass die bestehenden Arbeitsmodelle ganz einfach ausgedient haben: Niemand will oder kann mehr so arbeiten wie bisher. Die Folge davon ist eine epochale Veränderung, die erst am Anfang steht und noch nie dagewesene Konsequenzen auf die Finanzinstitute als Arbeitgeberinnen haben wird – aber genauso auf Behörden, Infrastruktur- und Immobilienanbieter.
Verwaiste Strassenschluchten
Einmal mehr sind die USA auch da dem Rest der Welt voraus. Schon auf der Höhe der ersten Pandemie-Welle im vergangenen Jahr war von verwaisten Strassenschluchten in Manhattan die Rede und von Arbeitskollegen, die sich in den Süden absetzen – nach Arizona oder Florida, wo stets die Sonne scheint. Und schon damals lautete die Befürchtung: Diese Banker werden nicht mehr ins Mekka der westlichen Hochfinanz zurückkehren.
Das scheint sich nun zu bewahrheiten. Nicht nur wegen des Wetters, sondern vor allem wegen der tiefen Steuern und der Tatsache, dass man schnell zurück ist im «Big Apple», falls man doch einmal einen Kunden treffen muss. Die Wall-Street-Institution Goldman Sachs überlegt sich offenbar, einen Teil ihres Asset Management in den «Sunshine State» (Florida) auszulagern – dort sitzen die Superreichen sowieso. Eine geplante Abgabe für Finanztransaktionen sowie eine «Reichensteuer», die der klamme Bundesstaat New York erheben könnte, sorgen für weitere Fliehkräfte.
Sehnsuchtsort Graubünden
Was für US-Banker Florida als Sehnsuchtsort darstellt, hat bei Schweizer Angestellten ein Pendant: das Bündnerland, wie finews.ch bereits im vergangenen August berichtete. Der Kanton Graubünden faszinierte schon immer viele Schweizerinnen und Schweizer.
Doch jetzt buhlen mehrere Regionen um Mitarbeitende aus der Finanzbranche. Seit der Lockdown der Welt beigebracht hat, wie Arbeiten von zu Hause selbst für Bankmitarbeitende geht, sind neue Arbeitsplatz-Konzepte «en vogue». Ein Beispiel ist das «InnHub La Punt», das der Verband Mia Engiadina initiiert hat.
Pop-up-Hubs und Luxus-Chalets
Dabei handelt es sich um ein Zentrum mit Arbeits-, Seminar- und Sportmöglichkeiten, Detailhandel, einem Restaurant und einer Tiefgarage. Es ist privatwirtschaftlich finanziert und wird von Kanton, Region und Gemeinde unterstützt; nicht ohne den Hintergedanken, dereinst eine neue, kaufkraftstarke Bevölkerung anzuziehen. Obschon es erst 2023 seine Tore öffnen wird, gibt es bereits jetzt eine Pop-up-Variante, die sich einer enormen Nachfrage erfreut.
Ähnliche Erfahrungen macht Natasha Robertson. Sie gründete 2005 die Firma Bramble Ski. Es war der erste Luxus-Chalet-Anbieter in den Alpen mit Voll- und Halbpensions-Arrangements. Aufgrund von Corona hat sich die Nachfrage nach Langzeitvermietungen verdoppelt. «Der Aufenthalt in der sogenannten eigenen Blase boomt», sagt Robertson, die mittlerweile mehr als 100 handverlesene Immobilien in angesagten Orten wie Verbier, Zermatt, St. Anton oder Lech anbietet.
Keinen einzigen Kunden im Büro getroffen
Ganz offensichtlich entspricht dies einem echten Bedürfnis. «Wir haben ein Jahr lang keinen einzigen Kunden im Büro gehabt. Gleichzeitig haben wir während der Pandemie mehr Umsatz gemacht als im Jahr zuvor», sagt ein Zürcher Vermögensverwalter, der zunehmend im Bündnerland anzutreffen ist, um Geschäftsräumlichkeiten zu prüfen. Aus dem Slogan «Work from Home» wird zunehmend «Work from Anywhere».
Mittlerweile sind selbst globale Banken daran, sich der Zeitenwende zu stellen. Das grösste Finanzinstitut Europas, der britische HSBC-Konzern, will weltweit 40 Prozent seiner Büros schliessen, wie vergangene Woche zu vernehmen war. Kein Zweifel, dass andere Finanzinstitute diesem Beispiel folgen werden.
Raus aus der Agglomeration
Dabei ist ein Trend klar zu erkennen – das Stadt-Land-Gefälle. Das gilt auch für den Finanzplatz Zürich, wie die Immobilienfirma Jones LaSalle in einer kürzlichen Studie feststellte. Im Stadtgebiet sei der Markt nach wie vor ausgeglichen und erfreue sich einer intakten Nachfrage. Im Gegensatz dazu stehe in der Agglomeration von Opfikon/Glattbrugg – wo die Schweizer Grossbanken mit grossen Kapazitäten vertreten sind – schon jetzt mehr ein Drittel der Flächen leer.
Das wird sich nicht mehr ändern. Neue Unternehmen in der Finanzbranche, sogenannte Fintechs, beschleunigen die Entwicklung, von überall her zu arbeiten noch zusätzlich. Zum einen, weil sie sich aus pekuniären Gründen gar keine teuren Büros leisten können, und zum andern, weil ihre Dienstleistungen schon längst im virtuellen Raum sind – sprich in der «Cloud». Hinzu kommt, dass diese innovativen Startups mit ihren flachen Hierarchien als Arbeitgeber für Studienabgänge heute viel attraktiver sind als Banken.
Weitreichende Konsequenzen
Insofern wird der Finanzplatz, wie man ihn in der Vergangenheit gekannt hat, überall auf der Welt verschwinden respektive in die Cloud abwandern, – auf die man von überall her zugreifen kann, sei es aus dem Bündnerland, von Florida oder der Côte d’Azur.
Diese Entwicklung hat weitreichende Konsequenzen. Neben den überzähligen Geschäftsimmobilien wird es auch eine ganze physische Infrastruktur nicht mehr im selben Ausmass benötigen, also Restaurants, Hotels, Reiseanbieter und Unternehmen aller Art, die in der Vergangenheit von einer kaufkräftigen Klientel lebten, die Tag für Tag die Finanzplätze dieser Welt bevölkerte. In der Summe dürfte dies auch fiskalisch enorme Konsequenzen mit sich bringen. Denn weniger Geschäft in den Finanzmetropolen führt zwangsläufig zu einem geringeren Steuersubstrat.
Geld fliesst
Politische Entwicklungen wie der Brexit in Grossbritannien, die Demokratiebewegung in Hongkong oder die neu entflammte Frauenrechts-Debatte in Dubai sind weitere Faktoren, die sehr schnell die Reputation eines Finanzplatzes kippen können. Namhafte Banken in London haben bereits begonnen, Teile ihres Geschäfts in EU-Metropolen zu verlagern, ähnliches geschieht in Hongkong zugunsten von Singapur, Tokio und Seoul.
Damit tut die Finanzbranche bloss das, was das Geld per se tut: Es fliesst, es fliesst dorthin, wo der Widerstand am geringsten ist. Insofern wird das «Come and go as you please» im Arbeitsmarkt die Banken neben allen anderen Veränderungen am stärksten revolutionieren.
Liste mit Homeoffice-Arbeitsplätzen
Zum ersten Mal geht es in der Finanzbranche nicht darum, Arbeitsplätze zu streichen, sondern um die Frage, wie sie beschaffen sein müssen. Einen Eindruck dessen liefert der Ferienunterkunfts-Vermittler eBookers, der eine Liste mit den attraktivsten Homeoffice-Arbeitsplätzen in der Schweiz zur Verfügung stellt.