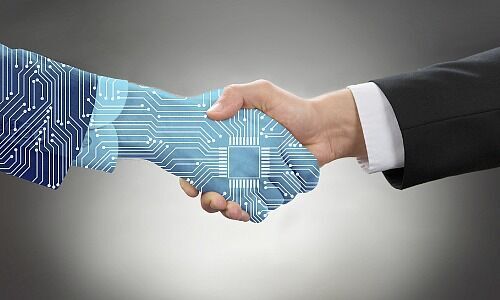Teodoro Cocca: «Welche Kunden sind wirklich disruptiv?»
Dieser Beitrag erscheint in der Rubrik finews.first. Darin nehmen Autorinnen und Autoren wöchentlich Stellung zu Wirtschafts- und Finanzthemen.
Die Angst vor der disruptiven Wirkung der Digitalisierung auf die Bankenbranche ist allgegenwärtig. Es geht schlichtweg um die Angst vor dem Verlust der puren Existenzberechtigung einer Bank. Wenn eine technologische Innovation ein bestehendes Produkt, eine Dienstleistung oder sogar das gesamte Geschäftsmodell verdrängt und überflüssig macht, ist der disruptive Effekt eingetreten.
Und in der Tat gibt es zurzeit eine immense Fülle an Konferenzen, an denen Start-Up-Pitchs aus allen Ecken der Welt in knackigen 3-Minuten-Präsentationen nicht weniger versprechen als die sichere nächste Revolution der Finanzindustrie. Zugegebenermassen haben einige dieser Fintech-High-Flyer auch tolle Konzepte und einige sind auf dem besten Weg zu bleibendem Erfolg. Dennoch dämmert in den letzten Monaten auch einer grossen Zahl von Anbietern aus der hippen «Digital Economy», dass technologische Innovation per se überhaupt keine Erfolgsgarantie darstellt.
«Dies wäre der disruptive Ernstfall oder das unbarmherzige Worst-Case-Szenario»
Dies ist dem Umstand geschuldet, dass sich eine technologische Innovation – so revolutionär und vorteilhaft sie auch scheinen mag – nicht automatisch durchsetzen wird. Entscheidend ist schlussendlich immer, ob Kunden eine Innovation annehmen oder nicht.
Aus Bankensicht stellt sich in diesem Kontext die besonders relevante (disruptive) Frage, ob eine Mehrheit von Kunden tatsächlich bereit wäre, eine Finanzdienstleistung nicht mehr bei einer klassischen Bank, sondern bei einem ursprünglich Nicht-Bank-Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Dies wäre der disruptive Ernstfall oder das unbarmherzige Worst-Case-Szenario, welches zurzeit bei Teilnehmern von Strategie-Workshops in Banken wie ein Damoklesschwert unheildrohend über den Köpfen schwingt.
«Für diese Kunden bedeutet Technologieaffinität nicht zwingend eine Abkehr vom traditionellen Bankmodell»
Es geht hier also nicht um die Frage, ob Kunden Bankdienstleistungen digital nachfragen, sondern es geht einen wesentlichen Schritt weiter auf der Skala der möglichen Disruption: Welche Kunden zeigen sich bereit, digitale Finanzdienstleistungen von völlig neuen Dienstleistern in Anspruch zu nehmen (BigTech, Fintechs & Co)? Anhand von kürzlich erhobenen Befragungsdaten lässt sich die Neigung zu disruptivem Verhalten von Bankkunden im Anlagegeschäft charakterisieren.
Dabei muss gleich mit einer ersten weit verbreiteten Meinung aufgeräumt werden: «Early Tech Adopters» sind nicht zwingend disruptiv. Wie unsere Daten belegen, gibt es in der Tat eine Kundengruppe, welche eine hohe Technologieaffinität und Neugierde gegenüber Innovationen aufweist.
Diese Neugierde motiviert diese Kunden auch dazu, neue Fintech-Angebote mit einem überschaubaren Anteil ihres Vermögens zu testen. Dennoch bleiben diese Kunden mit dem Grossteil ihres Vermögens der klassischen Bankbeziehung – zumindest bis heute – treu. Für diese Kunden bedeutet Technologieaffinität somit nicht zwingend eine Abkehr vom traditionellen Bankmodell. Bedrohlicher ist hingegen der Kundentyp, bei dem nebst der Technologieaffinität auch eine sehr skeptische und misstrauische Haltung gegenüber einem bankzentrierten Modell hinzukommt.
«Dann ist das toxisch-disruptive Gemisch komplett»
Entsprechend ist bei diesem Kundentyp die Gefahr der Substitution einer klassischen Bankbeziehung durch neue rein virtuelle Angebote viel stärker gegeben und diese Kunden stellen nun tatsächlich und unmittelbar eine disruptive Gefahr dar. In unseren Erhebungen macht dieser Anteil rund 15 Prozent der gesamten Kundenpopulation aus, was als ein sehr relevanter Anteil zu betrachten ist.
Dabei handelt es sich um eine Kundengruppe, welche typischerweise eher jünger, eher männlich, eher risikofreudig und eher gut über Finanzthemen informiert ist. Entscheidend ist dabei der Aspekt, dass eine steigende Technologieaffinität alleine noch kein hinreichendes Kriterium darstellt, um eine klassische Bankbeziehung in Frage zu stellen. Kommt aber zu einer hohen Technologieaffinität auch eine – nennen wir sie – «latente Bankskepsis» hinzu, ist das toxisch-disruptive Gemisch komplett
«Eine latent-kritische Haltung ist dabei die ausschlaggebende Grundmotivation»
Die daraus zu ziehende Lehre für die Banken sind einerseits die Feststellung, dass besonders technologieaffine Kunden nicht zwingend eine Gefahr für die Bank darstellen. Wie bereits von vielen Banken erfolgreich praktiziert, eignen sich dies Kunden dafür, die digitalen Kanäle innerhalb der bestehenden Bank zu nutzen. Andererseits ist abzuleiten, dass Disruption nicht alleine eine Frage der technologischen Innovation ist. Die subjektive Wahrnehmung und Einstellung zu Banken ganz generell spielt eine wesentliche Rolle.
Eine latent-kritische Haltung ist dabei die ausschlaggebende Grundmotivation und das primäre Handlungsmotiv, Banken den Rücken zu kehren. Die Nutzung der neuartigen technologischen Lösung ist in weitere Folge «nur» das Umsetzungsinstrument eines emotional tieferliegenden Antriebs. Gleichzeitig heisst dies aber auch, dass eine wirksame Anti-Disruptions-Strategie verschiedene Aspekte berücksichtigen sollte:
- Den technologieaffinen Kunden muss eine Plattform geboten werden, um ihre Technologieaffinität innerhalb der bestehenden Bank «ausleben» zu können.
- Der eigenen Image-Positionierung gegenüber derjenigen von BigTech-/Fintech-Unternehmen ist mehr Beachtung zu schenken.
Einmal mehr zeigt sich, dass traditionelle Banken bei der Digitalisierung die Trümpfe in Händen halten, wenn sie in der Lage sind ihre Kunden richtig zu verstehen. Gelingt dies aber nicht, wird der Anteil der latent zu disruptivem Verhalten neigenden Kunden zur echten Gefahr werden.
- Buchhinweis: «Digitalisierung im Private Banking», von Teodoro D. Cocca (Herausgeber), Armin Lauer (Herausgeber), Wolfgang J. Reittinger (Herausgeber), Frankfurt School Verlag
Teodoro D. Cocca ist seit 2006 Professor für Asset und Wealth Management an der Johannes Kepler Universität Linz. Davor war er einige Jahre bei der Citibank sowohl im Investment als auch im Private Banking tätig, forschte an der Stern School of Business in New York und lehrte am Swiss Banking Institute in Zürich. Zudem ist der Schweizer mit italienischen Wurzeln assoziierter Professor für Private Banking am Swiss Finance Institute (SFI) in Zürich und beratend für Finanzunternehmen und Behörden im In- und Ausland tätig. Seit April 2011 ist er Mitglied des Verwaltungsrats der VP Bank in Vaduz und leitet dort den Strategie- und Digitalisierungsausschuss.
Bisherige Texte von: Rudi Bogni, Oliver Berger, Rolf Banz, Werner Vogt, Walter Wittmann, Alfred Mettler, Robert Holzach, Craig Murray, David Zollinger, Arthur Bolliger, Beat Kappeler, Chris Rowe, Stefan Gerlach, Marc Lussy, Nuno Fernandes, Richard Egger, Dieter Ruloff, Marco Bargel, Steve Hanke, Urs Schoettli, Maurice Pedergnana, Stefan Kreuzkamp, Oliver Bussmann, Michael Benz, Albert Steck, Martin Dahinden, Thomas Fedier, Alfred Mettler, Brigitte Strebel, Mirjam Staub-Bisang, Thorsten Polleit, Kim Iskyan, Stephen Dover, Denise Kenyon-Rouvinez, Christian Dreyer, Kinan Khadam-Al-Jame, Robert Hemmi, Anton Affentranger, Yves Mirabaud, Hans-Martin Kraus, Gérard Guerdat, Mario Bassi, Stephen Thariyan, Dan Steinbock, Rino Borini, Bert Flossbach, Michael Hasenstab, Guido Schilling, Werner E. Rutsch, Dorte Bech Vizard, Adriano B. Lucatelli, Katharina Bart, Maya Bhandari, Jean Tirole, Hans Jakob Roth, Marco Martinelli, Thomas Sutter, Tom King, Werner Peyer, Thomas Kupfer, Peter Kurer, Arturo Bris, Frédéric Papp, James Syme, Dennis Larsen, Bernd Kramer, Ralph Ebert, Marionna Wegenstein, Armin Jans, Nicolas Roth, Hans Ulrich Jost, Patrick Hunger, Fabrizio Quirighetti, Claire Shaw, Peter Fanconi, Alex Wolf, Dan Steinbock, Patrick Scheurle, Sandro Occhilupo, Will Ballard, Michael Bornhäusser, Nicholas Yeo, Claude-Alain Margelisch, Jean-François Hirschel, Jens Pongratz, Samuel Gerber, Philipp Weckherlin, Anne Richards, Antoni Trenchev, Benoit Barbereau, Pascal R. Bersier, Shaul Lifshitz, Ana Botín, Martin Gilbert, Jesper Koll, Ingo Rauser, Carlo Capaul, Claude Baumann, Markus Winkler, Konrad Hummler, Thomas Steinemann, Christina Böck, Guillaume Compeyron, Miro Zivkovic, Alexander F. Wagner, Eric Heymann, Christoph Sax, Felix Brem, Jochen Möbert, Jacques-Aurélien Marcireau, Peter Hody, Ursula Finsterwald, Claudia Kraaz, Michel Longhini, Stefan Blum, Zsolt Kohalmi, Karin M. Klossek, Nicolas Ramelet, Søren Bjønness, Lamara von Albertini, Andreas Britt, Gilles Prince, Fabrizio Pagani, Darren Williams, Shanu Hinduja, Salman Ahmed, Stéphane Monier, Peter van der Welle, Swetha Ramachandran, Teodoro Cocca, Beat Wittmann, Ken Orchard, Michael Welti, Christian Gast, Didier Saint-Georges, Jürgen Braunstein, Jeffrey Vögeli, Gérard Piasko, Fiona Frick und Jean Keller.